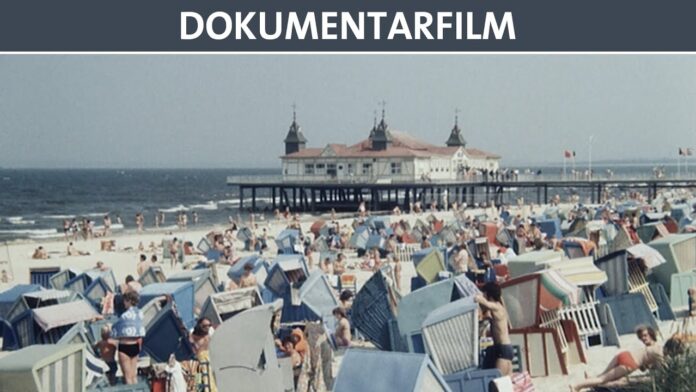Wer glaubt, Osttechnik war nur rückständig, irrt gewaltig. Die Deutsche Demokratische Republik brachte eine Reihe technischer Geräte hervor, die den Alltag prägten, oft erstaunlich robust waren und heute von Sammlern als Ikonen einer vergangenen Zeit gefeiert werden. Viele dieser „Technik-Wunder“ sind nach der Wende aus dem Blickfeld verschwunden, doch sie erzählen Geschichten von Einfallsreichtum, Treue und manchmal sogar von leiser Rebellion.
Die Erika, weit mehr als nur eine Schreibmaschine, war das „rhythmische Herz“ unzähliger Büros in der DDR. Auf ihr lernten Schüler das Zehnfingersystem. Sie war robust, zuverlässig und brauchte keinen Strom – einfach Papier einlegen und lostippen. Spätere Modelle boten sogar elektrische Funktionen. Heute wird die Erika als Ikone des Analogen gefeiert.
Der KC85 gilt als Computer der DDR, zumindest auf dem Papier. Er war ein grauer Kasten mit Steckmodulen, der an den heimischen Fernseher angeschlossen wurde. Programme mussten selbst geschrieben oder von Kassette geladen werden. Er war nicht schnell oder bequem, aber für viele der erste Kontakt mit der digitalen Welt und ein „kleines Fenster in die Zukunft“. Heute ist er fast vergessen.
In fast jeder DDR-Küche stand die Komet KM3, eine schwere, weiße und als unverwüstlich geltende Küchenmaschine. Sie konnte kneten, Sahne schlagen und raspeln, besonders der Fleischwolf-Aufsatz war legendär. Ersatzteile waren Mangelware, also wurde improvisiert und gebastelt. Sie war mehr als ein Gerät – ein Familienmitglied. Viele laufen noch heute, ohne Touchscreen oder App, aber mit Charakter.
Fernseher waren oft mehr als nur Geräte. Der Collar 40 war ein Möbelstück, groß, schwer und warm wie ein Heizlüfter. Er brachte Farbe und eine Fernbedienung ins Wohnzimmer. Empfang gab es im Secam-Format, Westfernsehen war nur nach heimlichem Umbau möglich. Er war zickig, lief aber über Jahre und Jahrzehnte und war das „Lagerfeuer der deutschen demokratischen Republik“. Der Clarissa war für viele der erste Fernseher, klobig, schwarz-weiß und mit einem kleinen Bildschirm, vor dem die Familie wie im Theater saß. Senderwechsel bedeutete Aufstehen und Drehen. Der Color X war der Stolz der DDR-Technik, volltransistorisiert, aber ebenfalls ein Klotz mit grellem Bild und blechernem Ton. Er stand wie ein Monument da. Der Chromat war ein „politisches Gerät“. Offiziell für Secam gebaut, ermöglichte er mit einem „Pal-Trick“ den Empfang von Westfernsehen – illegal, aber alltäglich. Er wurde zum „Fenster in eine andere Realität“, ein „kleiner Rebell“. Nach der Wende wurden diese Fernseher oft zu Müll.
Die Penti 2 war die Kamera der „kleinen Leute“, kompakt und schick. Sie war oft bei der Jugendweihe ein Geschenk und hielt Familiengeschichte auf 16mm Film fest. Die Farben waren leicht vergilbt, aber ehrlich. Nach der Wende passte sie nicht mehr ins System, da Orwo-Film kaum noch genutzt wurde. Heute ist sie Kult und beliebt bei Retro-Fotografen.
Das Smaragd Tonbandgerät war das Heim-Tonstudio, mit zwei Spulen und klarem Klang. Es diente dazu, Stimmen, Musik und Erinnerungen festzuhalten – ein Ritual des Fädelns und Justierens. Es ging nicht um schnelle Unterhaltung, sondern ums Festhalten. Nach der Wende verschwand es zugunsten von Kassette und CD.
Der Multimax HBM 250 war keine gewöhnliche Bohrmaschine, sondern ein „Werkzeug fürs Leben“. Schwer, laut, kompromisslos, stand er für Heimwerken als Überlebensstrategie. Er lief über Jahrzehnte, und wenn er zickte, wurde er repariert, notfalls mit selbstgebastelten Ersatzteilen. Er war Technik „ohne Show – nur Kraft, Ehrlichkeit und das leise Brummen der Eigenverantwortung“. Viele stehen noch heute einsatzbereit in Werkstätten.
Die K500 war keine Kaffeemaschine, sondern ein „Dampfdruckmonument“. Der Kaffee war stark, fast schwarz, mit einem Hauch Metall. Sie stand in Büros, Küchen und Werkstätten. In Zeiten knapper Bohnen wurde gestreckt und gemischt, doch das Ritual blieb. Wer sie heute wieder anschließt, behauptet oft, sie mache besseren Kaffee als jede neue Maschine.
Der Robotron A5120 war der Bürocomputer der DDR. Ein graues Monstrum mit grüner Schrift auf schwarzem Grund. Langsam und schwer, aber der Stolz jeder Behörde. Er war Werkzeug der Verwaltung in Silizium gegossen. Nach der Wende verschwand er auf Halde, heute blinkt er in Museen.
Der Komotron TC600 war der einzige offiziell produzierte Anrufbeantworter der DDR. Ein Kuriosum mit Minionband und einer Minute Aufnahmezeit. Er stand nicht im Wohnzimmer, sondern bei Funktionären oder in Hotels und war für normale Bürger unerreichbar. Heute ist er fast völlig verschwunden, ein Mythos der Endphase des Staates.
Die Pentaflex 8 war das „Auge der Familie“. Sie hielt wichtige Momente in ruckeligem Schwarz-weiß fest. Kurbeln, Belichten, Warten aufs Labor – das Ergebnis waren bewegte Bilder aus dem eigenen Leben. Sie war keine Kamera, sondern „Erinnerung in Reinform“.
Der K1520 war kein fertiger Computer, sondern ein Baukasten und Stecksystem, entwickelt für Labore und Klassenzimmer. Er war Hightech in der DDR und ein „Werkzeug für Menschen, die selbst gestalten wollten“, was in einem Land mit festen Grenzen fast revolutionär war.
Der Starsfurt K67 war ein tragbarer Fernseher, ein Koffer mit Bildschirm, Griff und Stolz. Er versprach Freiheit, indem er Fernsehen in die Datsche oder auf den Campingplatz brachte. Das Bild war klein, schwarz-weiß und rauschte, die Antenne musste gedreht werden. Er war technisch bescheiden, fühlte sich aber groß an – ein „Abenteuer in Röhrentechnik“.
Der K50 war das „Mixtape-Maschinengewehr der DDR“. Ein rechteckiger Klotz mit Antenne, mit dem man Radio hören, aufnehmen und sich selbst auf Kassette sprechen konnte. Musik aus dem Westen oder Jugendradio DT64 – alles wurde konserviert. Es ging darum, sich seine Welt selbst zusammenzustellen.
Die Kombi Waschmaschine war der Stolz vieler Haushalte. Kein Wunderwerk, sondern eine lärmende, vibrierende Kiste. Wasser wurde per Hand eingefüllt, Zeiten mechanisch eingestellt, und man blieb besser daneben, um Überschwemmungen zu vermeiden. Trotzdem war sie eine Befreiung vom Waschbrett – „Technik im Dienst der Hausarbeit“.
Die Sonneberg 500 war das „Klangmöbel der DDR“, ein Kasten mit Radio, Plattenspieler und Boxen. Sie verwandelte das Wohnzimmer in ein kleines Musikstudio, aus dem Reinhard Lakomy oder Karat rauschten. Musik bedeutete Rückzug und ein bisschen Freiheit. Heute wird sie als Zeitzeugnis gefeiert.
Und schließlich die CNC 600, das „stille Rückgrat der ostdeutschen Industrie“. Sie steuerte Fräsmaschinen und Bohrer, brachte Mikroelektronik in die Werkhallen. Sie war nicht schnell oder fehlerfrei, aber sie funktionierte und war das „Versprechen einer modernen Fertigung“. Nach der Wende wurde sie von westlicher Präzision überrollt.
Diese Geräte sind heute weitgehend verschwunden, oft auf dem Schrottplatz gelandet, in Kellern vergessen oder für wenige Mark verkauft. Doch sie leben weiter – in Gartenlauben, auf Flohmärkten, in Museen und bei Sammlern. Sie waren mehr als nur Technik; sie waren ein Stück Geschichte, Alltag zum Nacherleben und zeugen von einer Zeit, in der man improvisieren, basteln und das Beste aus dem machen musste, was vorhanden war. Jedes einzelne hatte Charakter und schuf Erinnerungen, die bleiben.