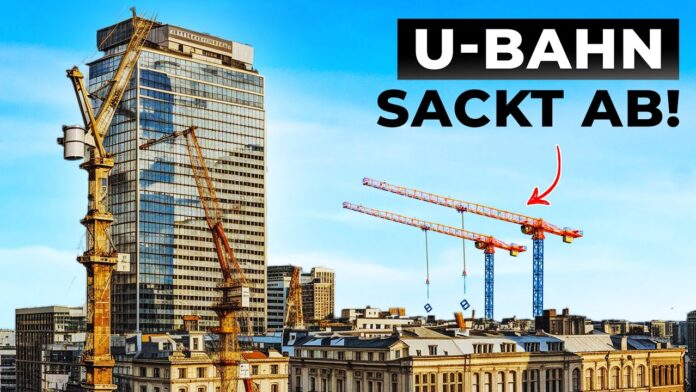Ein historisches Meisterwerk deutscher Eisenbahngeschichte, der VT 18.16, auch bekannt als SVT18.16 Görlitz, steht kurz vor seiner Rückkehr auf die Gleise. Nach einer jahrelangen Ruhephase und einer aufwendigen Restaurierung, die bereits 7 Millionen Euro gekostet hat, soll der einst so elegante Triebwagen schon bald wieder über die Schienen flitzen. Die ersten Probefahrten sind für August am Harz Nordrand zwischen Öburg und Aschersleben geplant.
Der VT 18.16 war einst der Star der Deutschen Reichsbahn. Vom Waggonbau Görlitz entwickelt, wurde der Prototyp 1963 auf der Frühjahrsmesse in Leipzig vorgestellt. Der Zug wurde speziell für den internationalen Verkehr konzipiert und verkehrte auf Strecken nach Skandinavien, Österreich und ins heutige Tschechien. Seine Bezeichnung SVT steht für Schnellverbrennungstriebwagen, da er dieselhydraulisch betrieben wurde – praktisch angesichts der nicht durchgängigen Elektrifizierung und unterschiedlichen Systeme. Die Zahlen 18 und 16 in seinem Namen weisen darauf hin, dass beide Triebfahrzeuge zusammen 1800 PS leisteten und der Zug bis zu 160 km/h schnell fahren konnte. Zwischen 1965 und 1968 wurden sieben weitere Triebzüge gebaut. Der letzte SVT wurde im Jahr 2003 ausgemustert. Der hier restaurierte Zug stammt übrigens aus dem Bestand des DB Museums in Nürnberg.
Die Wiederbelebung dieses „Stars“ ist ein Mammutprojekt, das von unermüdlichem Einsatz und Leidenschaft getragen wird. Im Führerstand bereitet sich Michael Brandes darauf vor, den 1000 PS Motor des Triebwagens zu starten, ein Moment voller Anspannung und Aufregung. Ein Teil des Zuges kann bereits aus eigener Motorkraft rollen, während an anderen Segmenten noch fleißig gearbeitet wird. Der Zug ist derzeit vierteilig, wobei ein weiterer Wagen in der Werkshalle entdeckt wurde und der letzte Teil noch versteckt ist.
Herzblut und Handarbeit: Die unsichtbaren Helden der Restaurierung
Die Restaurierung des SVT18.16 Görlitz, die von der 2018 gegründeten SVT Görlitz GmbH initiiert wurde, die den Zug 2019 zunächst witterungsgeschützt nach Dresden überführte, ist vor allem das Werk zahlreicher engagierter Eisenbahnfans. Diese Freiwilligen stecken ihre Freizeit und ihr Herzblut in das Projekt. Viele Arbeiten wären schlichtweg unbezahlbar, wäre da nicht der unermüdliche Einsatz dieser Menschen.
Zu den umfangreichen Aufgaben gehören:
• Der Einbau neuer Druckluftschläuche für die Bremsanlage, da die alten Schläuche nicht mehr verwendet werden konnten. Dies ermöglicht in Kürze die Durchführung erster Bremsversuche.
• Die komplette Aufarbeitung sämtlicher Fenster des Zuges, eine Aufgabe, die von einem einzelnen Restaurator mit großer Hingabe bewältigt wurde. Für ihn ist der Zug eine lebenslange Begleitung; er sah ihn bereits als 12-jähriges Kind regelmäßig zwischen Berlin und Wien verkehren.
Die Arbeiten finden in Halberstadt bei der Verkehrsindustriesysteme GmbH (VIS) statt, einem Standort mit über 180 Jahren Eisenbahngeschichte, der nach 1949 zu einem wichtigen Hersteller von Reisezugwagen für die Deutsche Reichsbahn wurde und heute noch Fahrzeuge instand hält.
Originaltreue trifft Barrierefreiheit
Das Ziel der Restaurierung ist die originalgetreue Wiederbelebung des VT 18.16. Doch das Projekt blickt auch in die Zukunft und öffnet Türen für Neues: Um den problemfreien Zugang für mobilitätseingeschränkte Personen zu ermöglichen, wird ein zweiter, klappbarer Türflügel an den Türen angebracht. Dieser kann eingeklappt werden, um die Türöffnung zu verbreitern. Im Innenraum, der wieder besichtigt werden konnte, sind Details wie Gardinen und die acht Sitzplätze im Zweite-Klasse-Abteil zu sehen.
Das gesamte Projekt hat bisher 7 Millionen Euro verschlungen und ist darauf angewiesen, dass geplante touristische Sonderfahrten Geld in die Kassen spülen. Es wird höchste Eisenbahn, dass der Zug in Betrieb genommen werden kann, denn die Fertigstellung der restlichen Arbeiten ist für das dritte Quartal dieses Jahres geplant, womit das Projekt eine geplante Verzögerung von fast zwei Jahren aufholen würde. Die erste Sonderfahrt ist bereits für den 6. September geplant, mit dem Ziel, jährlich 40 bis 50 Sonder- und Charterfahrten durchzuführen. Der Zug kann nicht in seine alte Halle in Dresden zurückkehren, aber eine neue Halle wird derzeit in Radebeul gebaut.
Neben dem SVT Görlitz konnten Besucher beim Tag der offenen Tür in Halberstadt auch andere interessante Wagen bestaunen, darunter sogenannte Orient Express- oder Rheingoldwagen, die ebenfalls auf ihr neues Leben warten und restauriert werden sollen.
Mit den bevorstehenden Probefahrten und dem Start der Sonderfahrten rückt der Traum vieler Eisenbahnfreunde und die Wiederbelebung eines wertvollen Stücks Eisenbahngeschichte in greifbare Nähe. Der alte neue SVT Görlitz wird bald wieder zu sehen sein – so wie einst.