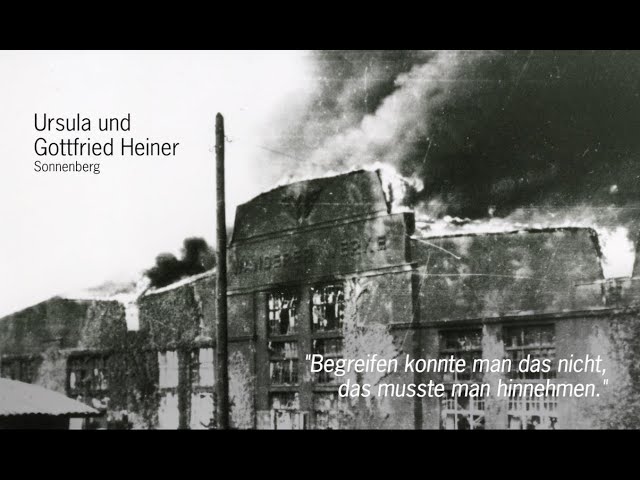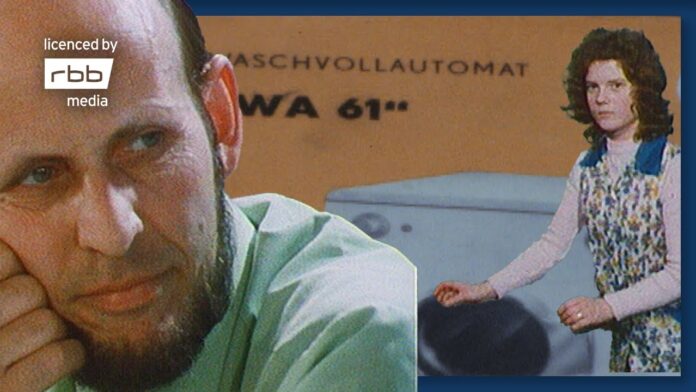Rügen, das weite Windland an der Ostsee, offenbart sich als ein einzigartiges Reiseziel, dessen Landschaft von der Eiszeit geformt wurde und wo das Meer, was es raubt, an anderer Stelle zurückgibt. Hier ist der Pulsschlag das Licht, und der Gast auf Rügens Halbinseln, wie Wittow, kann entweder ganz einfach oder luxuriös, oder ganz einfach luxuriös wohnen. Luxus bedeutet hier, den Sonnenaufgang mit einer Tasse Kaffee zu genießen und den Sonnenuntergang im windgeschützten Strandkorb mit Glühwein zu erleben.
Wittow: Das Fahrradparadies im Norden
Die Halbinsel Wittow ist ein wahres Paradies für Radfahrer, da von den „fünf Hauptfeinden des Radfahrers“ nur der Wind immer präsent ist. Regen ist selten, Autos und Berge kaum vorhanden, und schwer befahrbare Wege findet man nur, wenn man sie wirklich sucht. Der Ostseeküstenradweg führt zum Beispiel in Richtung Kap Arkona.
Wer sich zwischendurch erholen möchte, findet im Steilküstencafé „Zur kleinen Rast“ mit Sanddornspritz und Meerblick eine willkommene Pause. Hier kann man auch das Geheimnis der windschiefen Biergläser der Stralsunder Störtebeker Brauerei lüften: Sie wurden so entworfen, damit sie auf den Tischen in Vitt stehen können.
Das Fischerdorf Vitt hat seinen Charme bis heute bewahrt. Hier musste Pfarrer Kosegarten, da die Fischer während der Heringssaison nicht zu seinen Predigten in die Kirche kommen konnten, zu ihnen kommen. Seine Predigten fanden in Fischerhäusern oder am Strand unter freiem Himmel statt, oft mit freiem Blick auf Kap Arkona, was das Verständnis seiner Worte mitunter beeinträchtigte. Dieser Umstand führte zur Genehmigung des schwedischen Königs Gustav und mit Kosegartens eigenem Geld zum Bau der achteckigen, einfach gehaltenen Uferkapelle auf einer Anhöhe über dem Dorf. Die Aufwertung des Innenraums mit dem Gemälde „Menschen im Sturm“ im Jahr 1990 konnte Kosegarten, der bereits 172 Jahre zuvor 1818 in Greifswald starb und seine Schulden nie loswurde, jedoch nicht mehr miterleben.
Der Name Puttgarten bedeutet „am Fuße einer Burg gelegen“, was zutreffend ist, da man von weitem hinter dem ehemals militärisch genutzten Peilturm (1927-1945) den mächtigen Wall der Jaromesburg, einer ehemaligen Slawenburg, sieht. Diese Burg war dem viergesichtigen Gott Swantow gewidmet. In Puttgarten lockt der Rügenhof, ein ehemaliges Landgut, mit Kunsthandwerksgeschäften in ehemaligen Scheunen und Ställen, die wohl hauptsächlich weibliche Kundschaft anziehen. Währenddessen können Männer im gegenüberliegenden „Woody’s Little Britain“ einen englischen Tee trinken.
Kap Arkona: Leuchttürme und Historie
Die Leuchttürme auf Kap Arkona sind eine Hauptattraktion. Der ältere der beiden, fast 200 Jahre alt, trägt Schinkels Handschrift und beherbergt heute das höchste Standesamt des Landes. Vom jüngeren Turm aus bietet sich nach 164 Stufen eine weite Aussicht über das Wittower Hinterland, die Jaromesburg und das Meer. Der Eintritt zu den Leuchttürmen ist mit der Kurkarte oder Hartgeld möglich. Vorbei an der Belüftungsanlage einer historischen militärischen Bunkeranlage, die heute ein Museum ist, führt der Radweg weiter zum nördlichsten Punkt der Insel, dem Gellort, etwa 1500 Meter vom Leuchtturm entfernt. Hier liegt auch der Siebenschneiderstein, ein Mitbringsel der Eiszeit und der viertgrößte Findling Rügens.
Die Wanderung von hier zum Nordstrand, einem der schönsten Strände der Insel, ist besonders im Herbst mit leichtem Wind, Meeresrauschen und Nieselregen reizvoll. Die Radwege auf der flachen Halbinsel Wittow scheinen alle in die Unendlichkeit zu führen. Wer nicht den Mut hat, abseits der befestigten Straßen entlang der Küstenlinie zu fahren, verpasst beeindruckende Aussichten.
Altenkirchen und Wiek: Kirchen, Bahnen und Surferparadies
In Altenkirchen steht die älteste Kirche Rügens, erbaut ab 1185 unter Einbeziehung eines Steines aus der Jaromesburg, dem sogenannten Swantowstein. Pfarrer und Dichter Kosegarten war hier 16 Jahre lang tätig und wurde nach seinem Tod 1818 in Greifswald auf eigenen Wunsch auf dem Kirchhof begraben.
Bei der Weiterfahrt stößt man auf Reste der ehemaligen Rügenschen Kleinbahn, wie den ehemaligen Güterschuppen und den Triebwagenschuppen. Die Strecke Fährhof-Altenkirchen wurde wohl bereits 1967 stillgelegt.
Wiek, am gleichnamigen Bodden gelegen, ist ein Paradies für Surfer. Die St.-Georgs-Kirche in Wiek, aus dem Jahr 1400, kommt ohne Kirchturm aus und ist eine der geräumigsten Kirchen Rügens. Am Wieker Hafen fällt die 1914 für den Kreideverlad erbaute, aber nie genutzte Kreidebrücke auf, die heute ein touristischer Aussichtspunkt ist. Auch hier befand sich ein Bahnhof der Rügenschen Kleinbahn. Hinter Wiek zweigte eine militärisch genutzte Stichstrecke nach Dranske ab.
Dranske, auf einer Landzunge zwischen Wieker Bodden und Ostsee gelegen, atmet Militärgeschichte aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie der DDR-Zeit. Ein Museum in einem ehemaligen Militärgebäude informiert über diese Geschichte.
Hiddensee: Insel der Künstler und Geschichten
Um nach Hiddensee zu gelangen, muss man die Fähre von Schaprode aus nutzen. Hiddensee ist eine autofreie Insel, was ihren besonderen Charme ausmacht. Die Insel ist 17 Kilometer lang, maximal 3,5 Kilometer breit und ähnelt einem Seepferdchen. Die Wege zum Strand sind überall kurz.
Hiddensee bietet fast alles: eine Bäckerei, wo das 3,5 Kilogramm schwere Kastenbrot erfunden worden sein soll, Inseltheater, Inselkino und eine Windmühle. Die Insel war und ist eine Künstlerkolonie. Die „Blaue Scheune“ war von 1919 bis Anfang der 30er Jahre Heimstatt des Hiddenseer Künstlerinnenbundes. Berühmtheiten wie Heinrich George, Karl Zuckmayer, Ringelnatz, Fallada und Gerhard Hauptmann waren hier. Hauptmann definierte die Sommerzeit für Hiddensee mit seinem Weinkeller: War er voll, begann der Sommer, war er leer, endete er. Hauptmann und die Tänzerin Grete Palucca sind auf Hiddensee begraben.
Die Inselkirche, ein Überrest des ehemaligen Klosters, ist turmfrei, und die Glocken verbergen sich raffiniert im Kircheneingang, in einem der von Max Taut entworfenen Häuser. Der dänische Stummfilmstar Asta Nielsen gab sich im „Karussell“ genannten Haus die Klinke in die Hand. Auch der Gegenwartsautor Lutz Seiler war hier und verarbeitete die Geschichte einer verschworenen Gemeinschaft Schiffbrüchiger zur Zeit der sterbenden DDR, die sich in der Gaststätte „Zum Klausner“ zutrug, in seinem preisgekrönten Roman „Kruso“. „Zum Klausner“ am Dornbusch erreicht man zu Fuß und kann dort reiten lernen oder den Blick über die Insel genießen.
Jasmund: Nationalpark und Sagenwelt
Der Nationalpark Jasmund, eine Art „Rügener Schweiz mit Kreide“, ist geprägt von hohen Buchen, die sich im flachen Erdreich festzukrallen scheinen. Die Wanderwege der Stubnitz, einem Teil des Nationalparks, führen zur Stubbenkammer mit Königsstuhlaussicht. Die Victoria-Sicht, ein paar hundert Meter entfernt, bietet einen vielleicht weniger spektakulären, aber dafür oft ungestörten Blick auf den Königsstuhl.
Der Herthasee, eigentlich „schwarzer“ oder „Brocksee“ genannt, ist Schauplatz einer alten Sage: Die Göttin Hertha soll hier gebadet und anschließend ihre menschliche Gefolgschaft durch den See verschlingen lassen haben. Die Bewohner des am See gelegenen Burgwalls, einer Slawenburg, sollen der Göttin am Opferstein Menschenopfer dargebracht haben, deren abfließendes Blut Rinnen in die Erde grub.
Im Breger Hafen bereiten sich Segelboote auf ihren Winterschlaf vor.
Juliusruh und die Schabe: Strand und Stille
In Juliusruh, wo Studenten bis 1988 vormilitärische Ausbildung absolvierten, findet man hinter dem Küstenschutzwald den 8 Kilometer langen und sehr breiten, geschützten Strand auf der Schabe, der Verbindungslandzunge zwischen Wittow und Jasmund. Wer mit offenem Geist auf dieser Insel unterwegs ist, wird hier „sein snde wit“ finden – man darf nur nicht danach suchen. Denn auf Rügen ist der Pulsschlag das Licht.