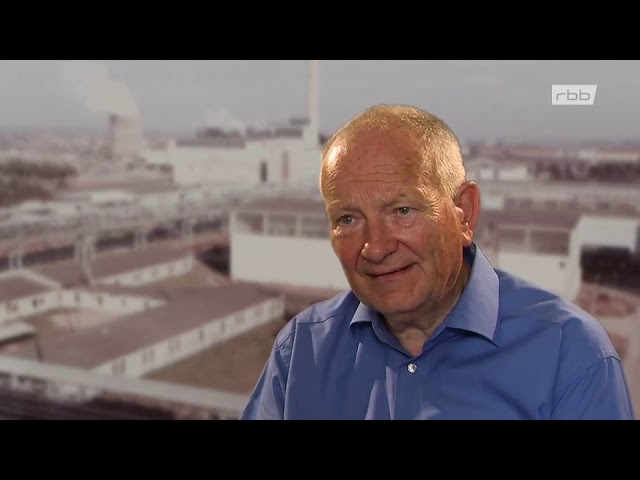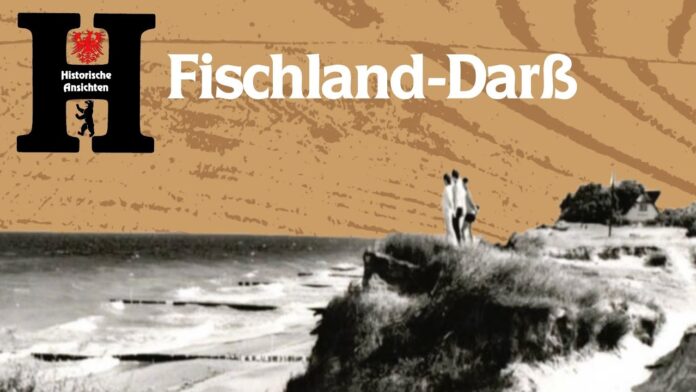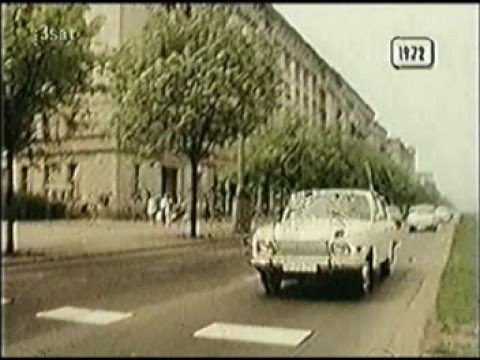In ihrem neuen Buch Freiheit gibt Angela Merkel spannende Einblicke in ihre 16 Jahre als Bundeskanzlerin sowie ihr Leben vor der politischen Karriere in der DDR. Das Werk beleuchtet sowohl politische Entscheidungen als auch persönliche Erfahrungen, die sie geprägt haben. Im dazugehörigen Interview spricht Merkel offen über ihre Beweggründe, die Herausforderungen während ihrer Amtszeit und ihre Gedanken zu den drängenden Fragen unserer Zeit.
Merkel reflektiert zentrale Ereignisse ihrer Kanzlerschaft, wie die Flüchtlingskrise 2015, die Corona-Pandemie und die Klimapolitik. Sie erklärt, dass sie das Buch schreiben wollte, um ihre Motive zu erläutern und die Werte zu verteidigen, die ihr in diesen Krisen wichtig waren. Ehrlichkeit und Authentizität waren ihr dabei ein großes Anliegen – ebenso wie der Versuch, einen Blick hinter die Kulissen der Macht zu gewähren.
Die ehemalige Kanzlerin spricht auch über ihre persönliche Entwicklung, etwa ihre späte Einsicht, wie wichtig der Feminismus ist, und ihre Überzeugung, dass sie mit ihrer Politik Frauen und Mädchen Mut machen konnte. Ihre Erfahrungen in der DDR, wo Freiheit keine Selbstverständlichkeit war, prägen ihren Blick auf gesellschaftliche Werte und die Bedeutung demokratischer Prinzipien bis heute.
Neben politischen Themen beleuchtet das Buch auch Merkels menschliche Seite: ihre Vorliebe für Hausmannskost, ihr Wunsch, mit Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren, und ihr Bedürfnis nach einem geschützten Privatleben. Sie gibt zu, dass sie sich oft zurücknehmen musste, um Konflikte zu vermeiden, und hofft, dass sie im Ruhestand mehr Raum für persönliche Dinge haben wird.
Ein weiteres zentrales Thema ist ihr Verhältnis zu Russland und Wladimir Putin, dessen Verhalten sie kritisch bewertet. Merkel schildert, wie sich die geopolitische Landschaft in Europa durch den Ukraine-Krieg verändert hat, und betont die Notwendigkeit, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Gleichzeitig unterstreicht sie die Wichtigkeit, die freiheitlichen Werte Europas zu bewahren.
Das Buch Freiheit ist mehr als eine politische Rückschau – es zeigt eine Kanzlerin, die nicht nur auf ihre Erfolge, sondern auch auf Herausforderungen und Fehler blickt. Es ist ein Appell, Freiheit, Respekt und Demokratie in einer zunehmend polarisierten Welt zu bewahren. Mit diesem Werk lädt Merkel dazu ein, ihre Perspektiven nachzuvollziehen und über die großen Fragen unserer Zeit nachzudenken.