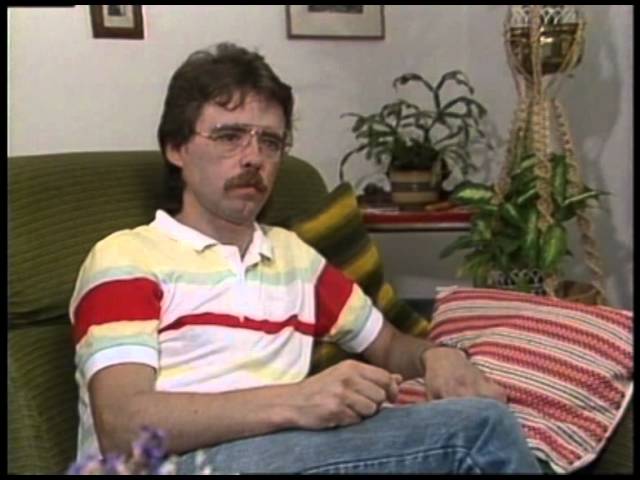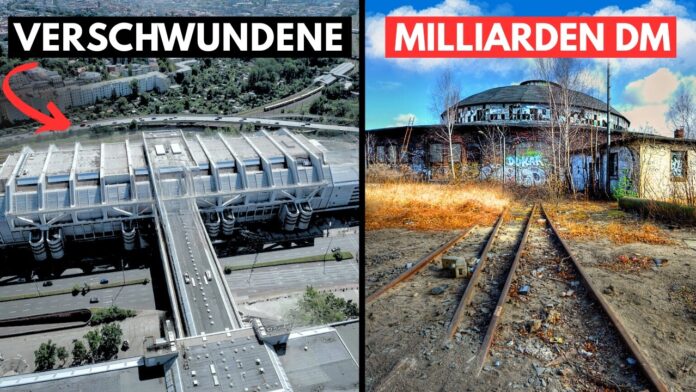Magdeburg, die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, war in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs nahezu vollständig zerstört. Dennoch sind an vielen Orten der Stadt bis heute Spuren ihrer historischen Vergangenheit zu erkennen oder zumindest zu erahnen. Wenn man durch ausgewählte historische Fotografien der Stadt blickt, kommt unweigerlich der Wunsch auf, den Standpunkt nachzuvollziehen, von dem aus die Fotografen ihre heute so wertvollen Bilder gemacht haben. Diese Aufnahmen zeigen eine lebendige, dynamische Großstadt, die sich in der Zeit des Aufbruchs und des Wandels präsentierte. Es hat sich gelohnt, diese filmische Unternehmung umzusetzen. Trotz der unendlichen Mühe, die alten Bilder in ein neues Licht zu setzen und die vielen Herausforderungen zu meistern, ist der große Aufwand nach meiner Einschätzung gerechtfertigt. Lassen Sie uns gemeinsam in ein völlig neues, altes und noch nie gesehenes Magdeburg eintauchen.
Der Südturm der Johanneskirche: Ein Blick über die Stadt
Eines der faszinierendsten Dokumente der Geschichte Magdeburgs stammt von einem Fotografen, der sich auf dem Südturm der Johanneskirche befand. Um die Position des Fotografen nachzuvollziehen, muss man erst die 277 Stufen des Turms überwinden. Von dieser grandiosen Aussicht in Richtung Osten aus konnte er eine detailreiche Fotografie anfertigen, die mit einer damals typischen Plattenkamera entstand. Der Blick geht über ein Meer von Häusern mit unterschiedlichen Baustilen – ein beeindruckendes Zeugnis für die lange Geschichte der Stadt. Das Bild, das um etwa Ende der 1920er Jahre entstand, fasziniert allein durch seine Detailfülle und zeigt, wie Pferdevorwerke das Stadtbild prägten. Zu dieser Zeit gab es bereits die elektrische Straßenbahn, mit der die Magdeburger bis in den Herkuleskrug fahren konnten.
Erinnerungen an eine blühende Stadt
Besonders schön sind die alten Brückentore, die Strombrücke und die alte Zitadelle mit ihrer massiven Mauer, die zusammen mit dem Winterhafen markante Bildpunkte darstellen. Auf der linken Seite ist ein Teil der Friedrichstadt zu sehen, während das spätere Stadtteil Krakau nur als helle Ackerfläche zu erkennen ist. In der Nähe steht ein weiteres bemerkenswertes Gebäude aus der Gründerzeit, die heutige Büchnerstraße.
Ein noch viel älteres Foto, das etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgenommen wurde, zeigt ein gegenüberliegendes Haus, in dem Pferdevorwerke ebenfalls das Straßenbild bestimmten. An einem schönen Sommertag sieht man Soldaten, die sich auf das Gelände der Zitadelle bewegen. Dort befanden sich mehrere wichtige Gebäude, unter anderem das Mehlhaus zur Versorgung der Soldaten. Diese historischen Details vermitteln ein Gefühl für die damalige Zeit, in der die Stadt als eine der stärksten Festungen Preußens galt.
Barockstraßen und Einkaufsmeilen
Der breite Weg, einst als schönste Barockstraße Deutschlands gefeiert, verläuft vom Hassebachplatz bis zum heutigen Universitätsplatz. Die prächtigen Palaisbauten und Bürgerhäuser im Barockstil prägten das Bild dieser Straße. In der Ferne sind die Türme der Katharinenkirche zu sehen. Ein Foto aus den 1930er Jahren zeigt nicht nur die Straße, sondern auch flanierende Soldaten, die das Leben in dieser blühenden Stadt symbolisieren.
Die Fotografen führten uns auf den breiten Weg in Richtung Katharinentor, wo heute der alte Eingang der ehemaligen Kirche steht. Eine Statue der Schutzheiligen Katharina, mit Schwert und zerbrochenem Rad, ziert den oberen Bereich. In den 1930er Jahren sah die Straße deutlich lebendiger aus, mit zahlreichen Einzelhandelsgeschäften, die sie beleben. Ehemalige Bewohner Magdeburgs erinnerten sich lange an die Schönheit ihrer Stadt, doch ihre Stimmen sind heute längst verstummt.
Stimmungsvolle Aufnahmen der Stadtlandschaft
Ein weiteres eindrucksvolles Bild entstand 1938 und zeigt eine Straßenszene vor der Katharinenkirche, die sich von heutigen Straßenbildern kaum unterscheidet. Die Vielfalt der Architektur und die dynamische Lebensart, die sie verkörpern, ziehen den Betrachter in ihren Bann.
Ein Blick auf das Foto von der Katharinenkirche aus der Nordturm-Perspektive, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand, zeigt keine Autos, sondern Fuhrwerke und Kutschen. Es ist ein Fenster in die Vergangenheit, das den langsamen, aber charmanten Lebensstil jener Zeit widerspiegelt. Die Straßenbahnen sind noch nicht elektrisch, was der Stadt eine nostalgische Note verleiht.
Trümmer und Wiederaufbau
Der Krieg hinterließ jedoch auch seine Spuren. Die Zerstörung und der Tod kamen aus dem Westen, und innerhalb weniger Stunden wurden 90 % der Stadt unwiderbringlich zerstört. Tausende Magdeburger verloren in diesem Inferno ihr Leben, und über 200.000 Menschen verloren ihr Zuhause. Ein Fotograf hielt den Schrecken und das Entsetzen der Überlebenden in einem beeindruckenden Foto fest. Im Hintergrund erkennt man die Ruine der Katharinenkirche, ein mahnendes Symbol für die verheerenden Folgen des Krieges.
Die Ruinen sind nicht nur ein sichtbares Zeichen des Verlusts, sondern auch ein Teil des kollektiven Gedächtnisses der Stadt. Ein weiterer Fotograf fängt die Trümmerlandschaft vom Hochhaus der Volksstimme aus ein. Die einst lebhaften Straßen sind entvölkert, und der Blick reicht bis zum Kloster unserer lieben Frauen, dessen Gebäude ebenfalls in den Wirren des Krieges beschädigt wurden.
Ein neuer Anfang für Magdeburg
Mit dem nationalen Aufbauwerk begannen die Magdeburger in den 1950er Jahren, unermüdlich an der Beseitigung der Trümmer und dem Wiederaufbau zu arbeiten. Der Blick von der Johanneskirche reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus, und man kann die Ruinen des Stadttheaters und die Überreste der Heiliggeistkirche sehen. Die Stadtplaner hatten jedoch andere Prioritäten: der Wohnungsbau, die Erweiterung von Krankenhäusern und Schulen standen ganz oben auf der Agenda.
Die Ruine des Stadtteaters wurde 1958 durch Sprengung beseitigt, was den dramatischen Wandel in der Stadt widerspiegelt. Auch die Heiliggeistkirche verlor allmählich ihre ursprüngliche Gestalt. An ihrer Stelle entstanden neue Wohn- und Geschäftshäuser, die den magdeburgischen Bürgern ein neues Leben in der Stadt ermöglichen sollten.
Magdeburg heute
Heute ist Magdeburg eine dynamische, entwickelte Großstadt, die für ihre Bewohner, Gäste und Besucher aus aller Welt offensteht. Die Stadt hat sich von den Wunden des Krieges erholt und bietet eine Fülle von Geschichte und Kultur. Die historischen Fotografien, die die Stadt in ihrer Blüte und auch in ihrer Zerstörung festhielten, sind nicht nur Zeitzeugen, sondern auch Erinnerungen an das, was war und was aus diesen Ruinen entstanden ist.
Die Spuren der Vergangenheit sind bis heute sichtbar, und die Geschichten derer, die vor uns kamen, leben in den Straßen und Gebäuden weiter. Magdeburg bleibt ein Ort, der viel zu bieten hat, und die Fotografen, die diese Stadt durch ihre Linse erfasst haben, haben dazu beigetragen, dass wir ihre bewegte Geschichte nie vergessen.