 Wer heute an seine Kindheit in der DDR zurückdenkt, hat oft sofort einen ganz bestimmten Geruch in der Nase. Es ist eine Mischung aus Ordnung und Geborgenheit, die eine ganze Generation verbindet. Ein Streifzug durch eine vergangene Welt aus Linoleum und Pressspan.
Wer heute an seine Kindheit in der DDR zurückdenkt, hat oft sofort einen ganz bestimmten Geruch in der Nase. Es ist eine Mischung aus Ordnung und Geborgenheit, die eine ganze Generation verbindet. Ein Streifzug durch eine vergangene Welt aus Linoleum und Pressspan.
Wenn man heute moderne Kindertagesstätten mit ihren offenen Konzepten und pädagogisch wertvollen Holzlandschaften betritt, wirkt vieles fremd für jene, die im Osten Deutschlands aufgewachsen sind. Denn der Kindergarten der DDR war ein Kosmos für sich – eine kleine Insel in einer großen Welt, die nach festen Regeln funktionierte und doch für viele den Inbegriff von Sicherheit bedeutete.
Der olfaktorische Empfang
Der Tag begann oft mit einem ganz eigenen Duftakkord: Es roch nach Bohnerwachs, nach dem Haferbrei aus der Küche und nach frisch gewischtem Linoleum. Schon das Ankommen folgte einem festen Ritual. In der Garderobe markierten kleine Pappschilder das eigene Revier: Sonne, Katze oder Traktor. Die Gummistiefel standen in Reih und Glied, und im Winter hoffte man, dass die feuchte Jacke über Nacht an der Heizung getrocknet war.
Die Gruppenräume selbst waren Welten in Pastell. Spitzengardinen filterten das Licht und verströmten den leichten Duft von Waschpulver. Es war warm, manchmal zu warm, aber es war eine Wärme, die willkommen hieß.
Die „Tante“ als Fels in der Brandung
Das Herz dieser Einrichtungen waren die Erzieherinnen. Ihr unverwechselbares Erkennungszeichen war fast überall gleich: die Kittelschürze. Sie waren Respektsperson und Trösterin zugleich. Der Morgen begann mit dem gemeinsamen Lied – „Guten Morgen, liebe Sonne“ oder dem Klassiker „Kleine weiße Friedenstaube“ – gefolgt von der obligatorischen Frühgymnastik, bei der alle Arme im Takt wippten.
Doch hinter der Strenge verbarg sich oft Herzlichkeit. Bei Heimweh war die Schürze der „Tante“ der sichere Hafen, an den man sich drücken konnte, bis der Kummer verflogen war. Sie kannten ihre Schützlinge genau: den Klassenclown, den stillen Bastler und das Kind, das beim Mittagessen immer trödelte.
Fantasie statt Überfluss
Das Spielzeug war einfach, oft schon von vielen Generationen vor einem benutzt. Es gab den Kaufladen aus Pressspan, Holzbausteine und Puppen mit Wollhaaren. Doch gerade weil nicht alles im Überfluss vorhanden war, blühte die Fantasie. Aus leeren Konservendosen wurden Trommeln, aus Papprollen Ferngläser.
Besonders beim Basteln wurde improvisiert: Wenn das Papier knapp war, drehte man es einfach um und bemalte die Rückseite. Wer in dieser Umgebung einen bunten Aufkleber aus dem Westen besaß, hielt einen Schatz in den Händen, der ehrfürchtig bestaunt wurde wie ein Artefakt aus einer anderen Galaxie.
Von Zimt-Grießbrei und heißen Rutschen
Kulinarisch ist die Erinnerung an diese Zeit untrennbar mit dem Geschmack von Grießbrei mit Zimt, Kartoffeleintopf oder Milchreis verbunden. Es war der typische Geschmack der Gemeinschaftsverpflegung – einfach, aber sättigend.
Nach dem Essen senkte sich die Mittagsruhe über das Haus. In den Schlafräumen reihten sich kleine Holzbetten aneinander. Während im Hintergrund leise ein Märchen von der Kassette lief – begleitet vom Rauschen des Tonbands – kuschelten sich die Kinder unter ihre Decken. Oft war das eigene Kuscheltier von zu Hause der wichtigste Begleiter in den Schlaf.
Draußen auf dem Spielhof warteten Abenteuer, die heutigen Sicherheitsstandards wohl kaum mehr standhalten würden. Legendär bleibt die Rutsche aus Metall, die sich im Hochsommer in eine heiße Platte verwandelte. Wer hier rutschen wollte, brauchte entweder Mut oder eine robuste Hose.
Ein bleibendes Gefühl
Wenn am Nachmittag die Dämmerung einsetzte und die Eltern kamen, um ihre Kinder abzuholen, endete der Tag in dieser geschlossenen Welt. Was bleibt, ist mehr als nur die Erinnerung an Emmal-Teller und Wandfarben. Es ist das Gefühl einer Kindheit, die schlicht und ehrlich war. Eine Zeit, in der die Welt am Garderobenhaken endete und in der man sich, trotz oder gerade wegen der einfachen Verhältnisse, aufgehoben fühlte.


 Ein Rückblick auf den September 1986: Das DDR-Magazin „Prisma“ deckt auf, warum Bewohner in der Altmark ganze Urlaubstage opfern müssen, um sich die Haare schneiden zu lassen – und wie Bürokratie und fehlender Wille das Leben auf dem Land erschweren.
Ein Rückblick auf den September 1986: Das DDR-Magazin „Prisma“ deckt auf, warum Bewohner in der Altmark ganze Urlaubstage opfern müssen, um sich die Haare schneiden zu lassen – und wie Bürokratie und fehlender Wille das Leben auf dem Land erschweren.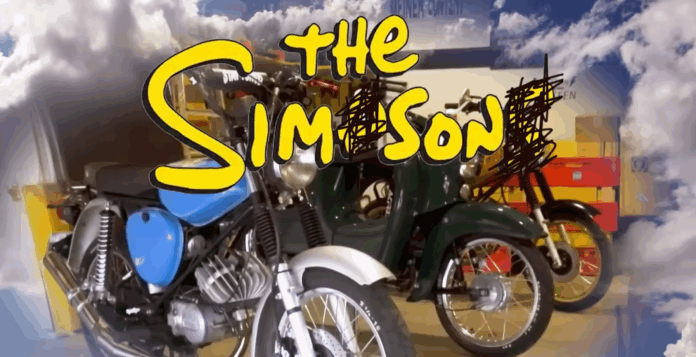
 Zwei westdeutsche YouTuber bereisen Ostdeutschland wie eine fremde „Map-Erweiterung“ in einem Videospiel. Was als satirischer „Fiebertraum“ beginnt, entwickelt sich zu einer der treffendsten Analysen der ostdeutschen Seele, die das Netz derzeit zu bieten hat.
Zwei westdeutsche YouTuber bereisen Ostdeutschland wie eine fremde „Map-Erweiterung“ in einem Videospiel. Was als satirischer „Fiebertraum“ beginnt, entwickelt sich zu einer der treffendsten Analysen der ostdeutschen Seele, die das Netz derzeit zu bieten hat.
 Es war das Jahr 1975, als Helmut Bunde seinen Dienst in Riesa antrat. Frisch vom Studium, motiviert durch christliche Werte und eine pazifistische Grundhaltung, startete der damals 23-Jährige bei der „Inneren Mission und Hilfswerk“, der heutigen Diakonie. Sein Auftrag war die Fürsorge. Doch was Bunde in den Kreisen Riesa und später Döbeln vorfand, hatte mit dem propagierten Bild der DDR-Gesellschaft wenig gemein. Er traf auf eine Realität, die politisch nicht existieren durfte: Menschen, die im Alkohol versanken, und Familien mit behinderten Kindern, die vom staatlichen Raster vollkommen ignoriert wurden.
Es war das Jahr 1975, als Helmut Bunde seinen Dienst in Riesa antrat. Frisch vom Studium, motiviert durch christliche Werte und eine pazifistische Grundhaltung, startete der damals 23-Jährige bei der „Inneren Mission und Hilfswerk“, der heutigen Diakonie. Sein Auftrag war die Fürsorge. Doch was Bunde in den Kreisen Riesa und später Döbeln vorfand, hatte mit dem propagierten Bild der DDR-Gesellschaft wenig gemein. Er traf auf eine Realität, die politisch nicht existieren durfte: Menschen, die im Alkohol versanken, und Familien mit behinderten Kindern, die vom staatlichen Raster vollkommen ignoriert wurden.
 Es ist ein Satz, der in der deutschen Nachkriegsgeschichte tausendfach gefallen ist, und er fällt auch in diesem verstörenden Filmdokument der ARD: „Wir konnten uns nicht vorstellen, was da im Lager passiert.“ Die Frau, die das sagt, ist keine unbeteiligte Zivilistin aus der nächsten Stadt. Es ist Hilde Lisewitz, eine ehemalige Aufseherin im Konzentrationslager Bergen-Belsen.
Es ist ein Satz, der in der deutschen Nachkriegsgeschichte tausendfach gefallen ist, und er fällt auch in diesem verstörenden Filmdokument der ARD: „Wir konnten uns nicht vorstellen, was da im Lager passiert.“ Die Frau, die das sagt, ist keine unbeteiligte Zivilistin aus der nächsten Stadt. Es ist Hilde Lisewitz, eine ehemalige Aufseherin im Konzentrationslager Bergen-Belsen.
 Wer an Willy Brandt und den Herbst 1989 denkt, hat meist sofort einen Satz im Ohr: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ Dieser am 10. November vor dem Schöneberger Rathaus ausgesprochene Satz wurde zum emotionalen Leitmotiv der deutschen Einheit. Doch ein fast vergessenes Interview, das Brandt nur drei Wochen später gab, zeichnet ein differenzierteres Bild des SPD-Ehrenvorsitzenden. Es zeigt einen Politiker, der nicht die schnelle Übernahme, sondern einen neuen Weg suchte.
Wer an Willy Brandt und den Herbst 1989 denkt, hat meist sofort einen Satz im Ohr: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ Dieser am 10. November vor dem Schöneberger Rathaus ausgesprochene Satz wurde zum emotionalen Leitmotiv der deutschen Einheit. Doch ein fast vergessenes Interview, das Brandt nur drei Wochen später gab, zeichnet ein differenzierteres Bild des SPD-Ehrenvorsitzenden. Es zeigt einen Politiker, der nicht die schnelle Übernahme, sondern einen neuen Weg suchte.


 Ein Rückblick auf ein Jahr, in dem der DDR-Musik leiser wurde und die Poesie lauter. Über vier Lieder, die eine ganze Ära spiegeln: von Holger Biege bis Gaby Rückert.
Ein Rückblick auf ein Jahr, in dem der DDR-Musik leiser wurde und die Poesie lauter. Über vier Lieder, die eine ganze Ära spiegeln: von Holger Biege bis Gaby Rückert.
 Während David Hasselhoff blinkend an der Mauer stand und die Scorpions den „Wind of Change“ herbeipfiffen, schrieb Dirk Michaelis mit der Band Karussell ein ganz anderes Stück Musikgeschichte. „Marie – die Mauer fällt“ ist keine bloße Jubelhymne. Es ist eine melancholische Warnung, die den Kater der Wiedervereinigung vorhersah, noch bevor die Sektflaschen leer waren.
Während David Hasselhoff blinkend an der Mauer stand und die Scorpions den „Wind of Change“ herbeipfiffen, schrieb Dirk Michaelis mit der Band Karussell ein ganz anderes Stück Musikgeschichte. „Marie – die Mauer fällt“ ist keine bloße Jubelhymne. Es ist eine melancholische Warnung, die den Kater der Wiedervereinigung vorhersah, noch bevor die Sektflaschen leer waren.
 Ein Rückblick auf den März 1989: Das DDR-Magazin „Prisma“ zeichnete ein kritisches Bild der Wohnsituation in Plauen. Während die Stadtverwaltung glaubte, das Gröbste überstanden zu haben, stapelten sich die Anträge. Für viele Bürger hieß die Realität: Waschen in der Schüssel und Warten auf die Zuteilung.
Ein Rückblick auf den März 1989: Das DDR-Magazin „Prisma“ zeichnete ein kritisches Bild der Wohnsituation in Plauen. Während die Stadtverwaltung glaubte, das Gröbste überstanden zu haben, stapelten sich die Anträge. Für viele Bürger hieß die Realität: Waschen in der Schüssel und Warten auf die Zuteilung.