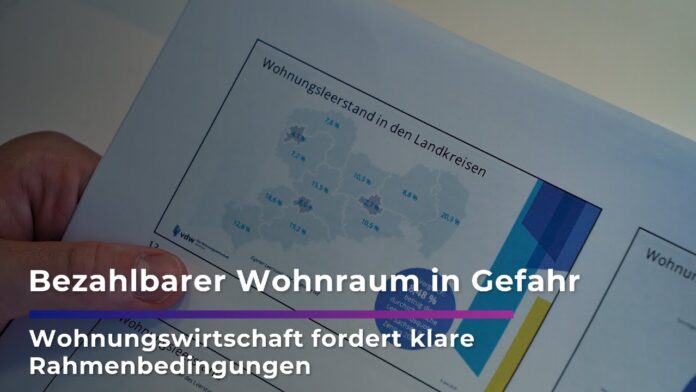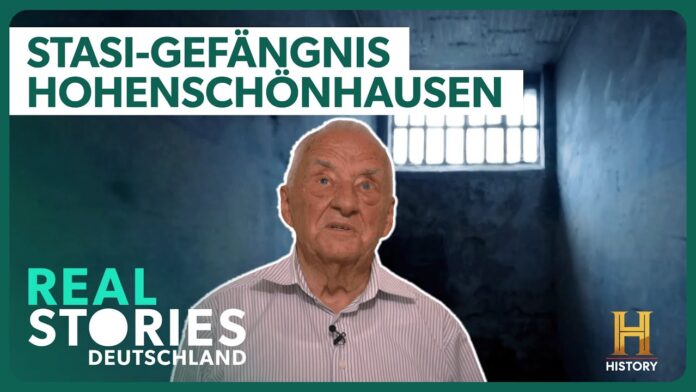Im Osten Berlins, mitten in einem Wohngebiet, steht ein Koloss, der einst zu den bestgehüteten Geheimnissen der DDR zählte: Das Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. Offiziell existierte dieser Ort nicht – auf keinem Stadtplan der DDR war er eingezeichnet, stattdessen nur ein weißer Fleck. Heute ist Hohenschönhausen eine Gedenkstätte und offen für Besucher, doch eine Erkundungstour in seinen Mauern bleibt eine Grenzerfahrung, ein tiefes Eintauchen in eines der dunkelsten Kapitel deutsch-deutscher Geschichte.
Das Gelände wurde 1951 vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) von der sowjetischen Besatzungsmacht übernommen und zu einer Stasi-Hochburg ausgebaut. Rund um das Gefängnis befanden sich Stasi-Behörden, Mitarbeiter wohnten sogar in unmittelbarer Nähe. Für alle anderen war das Gebiet Sperrzone. Bis zur Wende saßen hier über 10.000 Menschen ein – darunter Schriftsteller, Andersdenkende, Künstler, Politiker. Ihnen wurde Regimekritik oder geplante Republikflucht vorgeworfen. Die DDR schloss ihre eigenen Bürger nach dem Mauerbau 1961 ein, offiziell zum Schutz vor „schädlichen Einflüssen aus dem Westen“. Die Stasi, die Geheimpolizei der DDR, setzte alles daran, die Diktatur zu stützen und jeglichen politischen Widerstand zu zersetzen. Das Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen spielte dabei eine Schlüsselrolle.
Totale Isolation und Psychoterror als Methode
Eine der wichtigsten Stasi-Methoden war die totale Isolation der Gefangenen. Schon die Sowjets nutzten ein unterirdisches Verlies, das sogenannte „U-Boot“. Hier saßen Gefangene monatelang in Einzelhaft, abgeschnitten von der Außenwelt. Spätere Zellen waren zwar nicht unterirdisch, aber ebenfalls auf maximale Desorientierung ausgelegt. Die Zellen waren klein – zum Beispiel zwei Quadratmeter groß – hatten keine Fenster (oder nur solche mit dickem Ziegelglas) und es brannte ständig Licht. Das Ziel: Die Gefangenen sollten jedes Zeitgefühl und jede Orientierung verlieren.
In den Zellen herrschte absolute Stille. Sprechen, Singen oder Pfeifen war verboten. Kontakt zu anderen Gefangenen gab es nicht, sprechen durfte man nur mit seinem Vernehmer. Um sich abzulenken, versuchten Gefangene wie Arno Treffke, der 1953 als 19-Jähriger festgenommen wurde, sich Worte auf die Handfläche zu schreiben, da es keine Bücher, Zeitungen oder Schreibutensilien gab. Selbst kleinste private Gegenstände waren in den Zellen verboten.
Neben der physischen Isolation setzte die Stasi auf systematischen Psychoterror. Arno Treffke erlebte eine Tortur aus Schlafentzug, Hunger und stundenlangen Verhören. Besonders zermürbend waren oft die kleinen, täglichen Schikanen. Schließer trugen Hausschuhe mit Filzsohlen, waren also absolut nicht zu hören, wenn sie Gefangene beobachteten. Wenn sie weggingen, schauten sie aber bewusst mit der Klappe am Guckloch, um den Gefangenen alle acht bis zehn Minuten zu signalisieren: „Jetzt wirst du kontrolliert“, um dies „einzuhämmern“.
Die Vernehmer spielten eine Schlüsselrolle. Jörg Kirschner, 1979 wegen Buchschmuggels verhaftet, erlebte in Hohenschönhausen sechs Monate Verhörterror. Die Vernehmer waren psychologisch geschult und setzten bewusst auf Zermürbung. Sie nutzten den anfänglichen „Haftschock“ für tägliche Verhöre und wechselten zwischen großer Freundlichkeit und ätzender Widerwärtigkeit. Auch das bewusste Vorenthalten von Briefen, wie es Kirschner erlebte, diente dazu, Gefangene mürbe zu machen.
Um Begegnungen zwischen Häftlingen zu verhindern, gab es auf den Fluren ein Ampelsystem. Wenn ein Gefangener zum Verhör gebracht wurde, wurde dies durch eine Lampe signalisiert, damit andere Insassen in ihren Zellen blieben. In den 1960er Jahren wurden Häftlinge teilweise auch zu zweit untergebracht – ein bewusster Trick der Stasi, damit sie sich gegenseitig aushorchten.
Arbeit und letzte Maßnahmen
Ab den 1980er Jahren diente Hohenschönhausen nicht nur als Untersuchungsgefängnis, hier saßen Gefangene auch ihre Haftstrafe ab. Sie mussten arbeiten; weibliche Häftlinge etwa in der Großküche, um das Essen für die anderen zuzubereiten. Essen wurde nicht in einem Speisesaal, sondern streng isoliert in Töpfen zu den Zellen gebracht.
Wer trotz aller Methoden widerständig blieb, landete in der Gummizelle im Keller – eine letzte Maßnahme, um auch die Unbeugsamen zu brechen. Diese Zelle war mit Gummi ausgepolstert, komplett schallisoliert und hatte keine gute Luft. Nach einer Woche hier, so die Annahme, sei man sicher zu jeder Aussage bereit, nur um herauszukommen.
Spuren des Widerstands und eine Parallelwelt
Trotz der drakonischen Bedingungen suchten Gefangene nach Wegen, Widerstand zu leisten oder ihre Menschlichkeit zu bewahren. Im ersten Stock befand sich eine Bibliothek – Zugang dazu war eine Vergünstigung für Kooperation. Beim genauen Hinsehen wurden Markierungen in den Büchern gefunden: unterstrichene Wörter wie „Unfreiheit“, „zahlt“, „Freiheit“. Ob dies stummer Protest, ein geheimer Code oder einfach ein Versuch war, durch Worte Trost zu finden, weiß bis heute niemand. Auf den Zellwänden ritzten Gefangene auch Markierungen ein, um die Zeit zu dokumentieren.
Schockierend erscheint die „Parallelwelt“ der Stasi-Mitarbeiter. In unmittelbarer Nähe des Foltertrakts, nahe dem „U-Boot“, befand sich ein Trakt für die Wärter und Vernehmer. Hier gab es eine Sauna und sogar ein Schwimmbecken, wo sie sich nach Dienstschluss entspannten. Die Vernehmer hatten in ihrem Trakt über 120 Verhörräume, die immer bereitstehen mussten, falls ein Häftling ein Geständnis ablegen wollte.
Das Erbe von Hohenschönhausen
Arno Treffke hielt den Psychoterror fünf Monate lang aus, bevor er ein Geständnis unterschrieb. Er bekam lebenslänglich wegen angeblicher Spionage, kam nach 10 Jahren frei – unter der Bedingung absoluten Stillschweigens. Aus Angst vor dem Psychoterror hielt er sich 25 Jahre daran; selbst seine Familie erfuhr erst nach der Wende von seiner Geschichte. Jörg Kirschner wurde nach zwei Jahren Haft von der Bundesregierung freigekauft.
Die Desorientierung der Gefangenen hatte System. Angehörige und Freunde hielten die Verschwundenen oft für tot. Selbst die Gefangenen wussten nicht, wo sie sich befanden. Die Ankunft war oft der erste Schock: Verdächtige wurden in fensterlosen Transportern, fahrenden Gefängniszellen, nach Hohenschönhausen gebracht, eingepfercht in winzigen Zellen. Die Neonbeleuchtung beim Ankommen war extrem hell, um gleich einen Schock auszulösen. Einmal im Gefängnis, hatte die Stasi sie rund um die Uhr im Blick. Im Kontrollraum, der Schaltzentrale, liefen die Kameras und Kontrolllampen zusammen.
Heute ist das ehemalige Stasi-Gefängnis eine Gedenkstätte mit 400.000 Besuchern pro Jahr. Es ist ein stummer Zeitzeuge düsterer Jahre. Die Erkundung zeigt, wie perfide das Überwachungssystem der Stasi war und welch psychische Qualen die Isolation bedeutete. Jeder, der in der DDR anders war – sei es durch Musikgeschmack, Bücherwahl oder einfach durch seine Meinung – konnte ins Visier der Stasi geraten und in Hohenschönhausen landen. Die Gedenkstätte sorgt dafür, dass diese Geschichte nicht vergessen wird. Das Wissen, dass die Stasi und die DDR nicht mehr existieren, ist dabei ein buchstäblich befreiendes Gefühl.