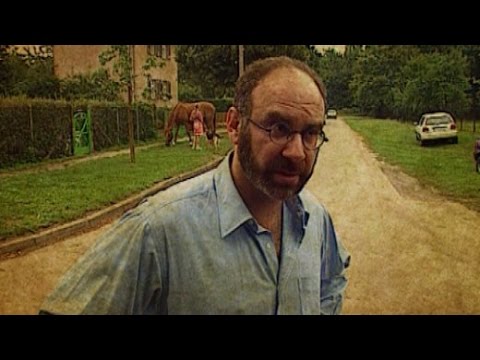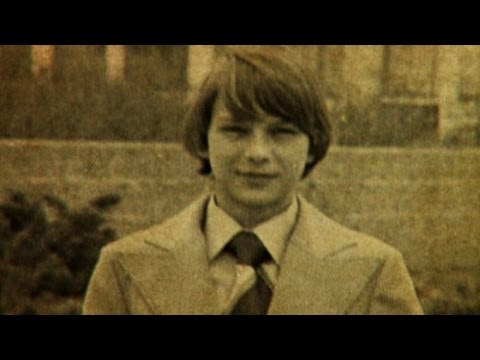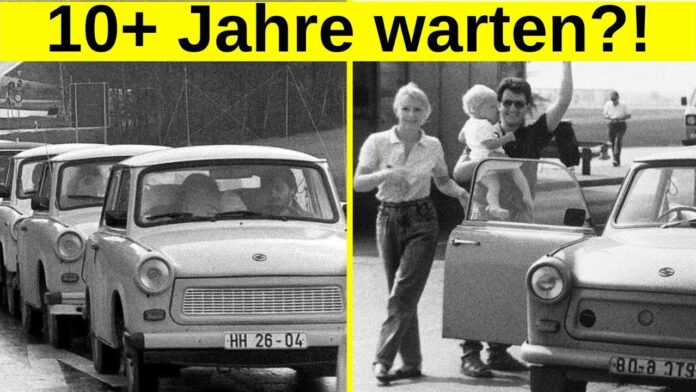Cottbus – Das 12. Cottbuser Stadtgespräch, veranstaltet vom Bürgerforum Cottbus, öffnete jüngst erneut den Debattenraum für die ungefilterte Bürgermeinung. Unter dem provokanten Titel „Net Zero Valley: Die Lausitz als Modellregion – Investition, Illusion, Diskussion“ standen die Zukunft der Region und die Herausforderungen der Energiewende im Mittelpunkt intensiver Debatten. Moderiert von Dirk Flindemann, bot der Abend Einblicke in das ambitionierte Projekt des „Net Zero Valley“ und konfrontierende Perspektiven zur deutschen Energiepolitik.
Das „Net Zero Valley“: Bürokratieabbau für die Industrieansiedlung
Dr. Markus Negemann, Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Cottbus sowie ein Verfechter des „Net Zero Valley“, präsentierte die Vision einer Modellregion, die entgegen gängiger Missverständnisse nicht primär auf Klimaschutz oder Emissionsfreiheit abzielt. Vielmehr, so Negemann, gehe es um den Abbau von Bürokratie und die Ansiedlung von Industrieunternehmen. Er räumte ein, dass dies kurzfristig sogar zu mehr CO2-Emissionen in der Region führen könnte.
Das Konzept des „Net Zero Valley“ basiert auf zwei wichtigen EU-Verordnungen vom Mai 2024: dem „Critical Raw Materials Act“ zur Stärkung der Resilienz bei kritischen Rohstoffen und dem „Net Zero Industry Act“. Dieser Act definiert 19 strategische Technologien (wie Batteriespeicher, Wasserstofftechnologien, intelligente Stromnetze, synthetisches Kerosin und Kernkraft), in die weltweit Milliardensummen investiert werden. Europa verliere jedoch den Anschluss bei der Produktion, da der Großteil der Investitionen nach Asien und Nordamerika fließe. Ziel des Acts sei es, diese Produktion in die EU zu holen, und die Lausitz wolle hier eine Vorreiterrolle spielen.
Ein zentraler Wettbewerbsnachteil Europas sei die langsame Genehmigungsverfahren. Während in China oder Nordamerika eine Fabrik in einem halben bis einem Jahr genehmigt werde, dauere dies in Europa drei bis fünf Jahre. Das „Net Zero Valley“ soll durch schnellere Genehmigungsprozesse, Bürokratieabbau in verschiedenen Rechtsgebieten (Datenschutz, Beihilfe-, Baurecht), gezielte Qualifizierungsprogramme (Net Zero Academy) und flexiblere Fördermittelanwendung Investitionen in diesen Technologien anlocken.
Die Lausitz, bestehend aus Industrie- und Handelskammern, Landkreisen und Städten, hat die Chance frühzeitig erkannt. Eine Task Force, der Dr. Negemann vorsteht, erarbeitete eine Bewerbung, die bereits im März als erster Antrag in ganz Europa dem zuständigen EU-Kommissar übergeben wurde. Das „Valley“ umfasst die gesamte Lausitz, fokussiert sich aber auf elf ausgewählte Industriegebiete mit über 800 Hektar Fläche. Die Region konzentriert sich auf Technologien rund um Batterie- und Energiespeicherlösungen, intelligente Stromnetze, Power X und Sektorenkopplung. Aktuell werde an der vorgeschriebenen strategischen Umweltprüfung gearbeitet, um im Oktober die offizielle Ausweisung als „Net Zero Valley“ zu erhalten. Negemann betonte die enge Zusammenarbeit mit anderen deutschen Initiativen wie der Weser-Ems-Region und hob hervor, dass die Lausitz hier schneller sei, obwohl sie als Kommunen agierten. Er verwies auf die Webseite netzerovalley.de für weitere Informationen.
Die ernüchternde Realität der Energiewende
Kontrastierend dazu präsentierte Lutz Hartig, Kraftwerks- und Diplomingenieur für Energiewirtschaft, eine kritische Analyse der Energiewende. Er stellte die Kernfrage, ob die bis 2045 angestrebte klimaneutrale Energiewende überhaupt möglich, sicher, umweltverträglich und bezahlbar sei, und zitierte den Bundesrechnungshof, der diese Frage mit „Nein“ beantwortet.
Hartig kritisierte die geringe gesicherte Leistung von Photovoltaik (0%) und Windkraft (6%), die einen enormen Bedarf an Backup-Kraftwerken, Elektrolyseuren, Wasserstoffspeichern und Batterien erforderten. Diese Systemkosten würden jedoch oft unterschlagen. Er verdeutlichte, dass Deutschland immer noch zu 80% auf fossile Energien angewiesen sei und Wind- und Solarenergie zusammen nur knapp 8% des Gesamtenergiebedarfs deckten. Die Behauptung der Regierung, 50% der Elektroenergie kämen aus Erneuerbaren, beziehe sich lediglich auf den Stromsektor, nicht auf Wärme und Verkehr.
Hartig präsentierte Berechnungen, die Atomstrom als die preiswerteste Energieerzeugungsart auswiesen, bei 2 Cent pro Kilowattstunde – ein Preis, den Deutschland erreicht hatte, als 30% des Stroms aus Kernenergie stammten. Die Stilllegung der deutschen Kernkraftwerke habe rund 500 Milliarden Euro gekostet und keine CO2-Einsparungen bewirkt. Die zunehmende Volatilität des Netzes führe zu einer dramatischen Zunahme der Netzbetreiber-Eingriffe – von etwa 10 im Jahr 2000 auf über 5.000 im ersten Quartal dieses Jahres. Er argumentierte, dass das System zunehmend unsicher werde und die Kosten explodierten.
Die globale Realität zeige einen Anstieg des Energieverbrauchs, wobei fossile Energien 77% ausmachten und die Kernkraft nicht signifikant gestiegen sei, da sie ohne CO2-Abscheidung teurer sei als Kohle oder Gas. Hartig zeigte auf, dass der Power-to-X-Prozess zur Wasserstofferzeugung mit 75% Energieverlust behaftet sei. Er betonte, dass eine Kernkraftvariante pro Jahr 160 Milliarden Euro einsparen könnte, keine Gaskraftwerke, Elektrolyseure oder Wasserstoffspeicher benötigte und die Netzkapazität um 75% reduziert werden könnte. Er kritisierte zudem, dass Deutschland eigene Gasvorkommen ignoriere und CCS-Technologien verbiete. Auch die Sprengung des modernen Kraftwerks Moorburg, das für eine CO2-Abscheideanlage prädestiniert gewesen wäre, sei ein Beispiel für Fehlentscheidungen.
Hartig wies darauf hin, dass viele hochentwickelte Industrieländer wieder stärker auf Kernenergie setzten und sich die EU-Kommission ebenfalls für den Ausbau stark mache. Er hob die Sicherheit von Kernkraftwerken hervor, deren Betrieb und Endlagerung als gefahrlos machbar gelten, wenn alle Vorschriften eingehalten werden. Die Entlagerung sei nur deswegen so teuer, weil sie nicht gewollt sei; tatsächlich existierten toxische Abfalllager, die giftigeren Müll aufnähmen. Zudem seien Brennstäbe zu 100% wiederverwertbar, und Deutschland verfüge über Kernbrennstoff für 500 Jahre Energieerzeugung. Hartig pries Small Modular Reactors (SMRs) als sichere, kostengünstige und flexible Lösung für die Zukunft, die auch die Abfallproblematik lösen könnten und international stark vorangetrieben würden, aber in Deutschland ignoriert.
Diskussion: Von CO2-Nutzen bis zur politischen Legitimation
Die anschließende Diskussionsrunde zeigte die breite Palette an Meinungen und Frustrationen des Publikums. Eine Frage zum Recycling von Solarpanelen und Windradflügeln hob die Schwierigkeiten hervor, während Kernkraft als vollständig recycelbar dargestellt wurde.
Kritik wurde an den im „Net Zero Valley“-Antrag genannten Projekten wie der Gigawatt-Fabrik der LEAG, Rocktech Lithium in Guben und dem Hydrogen-Projekt in Jänschwalde geäußert, da diese in Verzug seien oder Finanzierungsprobleme hätten. Dr. Negemann räumte Verzögerungen ein, betonte aber die strategische Bedeutung der Projekte und die Notwendigkeit, Pipeline-Projekte für die Bewerbung darzustellen.
Eine emotionale Debatte entzündete sich um CO2. Ein Zuhörer forderte eine „Lanze für das ach so giftige CO2“ und argumentierte, es sei essenziell für Pflanzen und die Begrünung der Erde. Er bezeichnete die gesamte CO2-Diskussion als „Schwachsinn“, die nur der Rechtfertigung der CO2-Steuer diene. Es wurde angeführt, dass Deutschland nur einen winzigen Bruchteil des globalen CO2-Ausstoßes verursache.
Die Frage nach der Energiesicherheit nach dem Kohleausstieg, insbesondere im Hinblick auf Polens Kernkraftausbau, wurde gestellt. Dr. Negemann konnte hier keine konkrete Antwort geben und verwies auf den Import von Atomstrom aus anderen Ländern, der jedoch Wertschöpfung ins Ausland verlagere. Er äußerte jedoch Optimismus bezüglich zukünftiger technologischer Fortschritte bei der Energiespeicherung.
Ein wiederkehrendes Thema war die allgemeine Bürokratie und die Frage, warum nicht generell die Bedingungen für Unternehmen verbessert, sondern stattdessen „Sonderwirtschaftszonen“ geschaffen würden. Dr. Negemann verteidigte das „Net Zero Valley“ als eine Chance, die Experimentierklausel des EU-Gesetzes zu nutzen, um von bestehender Regulatorik abzuweichen. Er betonte, dass die Lausitz Vorschläge mache, wie dies konkret umgesetzt werden könne, und dass dies eine „Riesenchance“ für die Region sei.
Die Rolle der Politik und die Entmündigung der Gesellschaft durch hohe Steuern und Subventionen wurden ebenfalls kritisch beleuchtet. Ein Zuhörer plädierte für eine „komplette Reform in diesem Land“ und mehr Freiheit für die Wirtschaft.
Schließlich wurde die Frage nach der Legitimation der „Lausitz“ aufgeworfen, die sich für das Projekt bewirbt. Dr. Negemann erklärte, dass ein achtköpfiges Gremium aus Vertretern der IHKs, HWKs, Landkreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden die politische Legitimation habe, da diese Vertreter gewählt oder durch Mitgliedschaften in Kammern legitimiert seien.
Der Abend endete mit der Erkenntnis, dass die Debatte um die Energiepolitik und die Zukunft der Lausitz weit über das Technische hinausgeht und tief in Fragen von Vertrauen, politischer Steuerung und gesellschaftlichen Werten verwurzelt ist. Das Bürgerforum Cottbus wird die Diskussionen am 11. September mit einem Themenabend zum Bargeld und am 1. August mit dem nächsten Stadtgespräch zur „Agenda 2030“ fortsetzen.