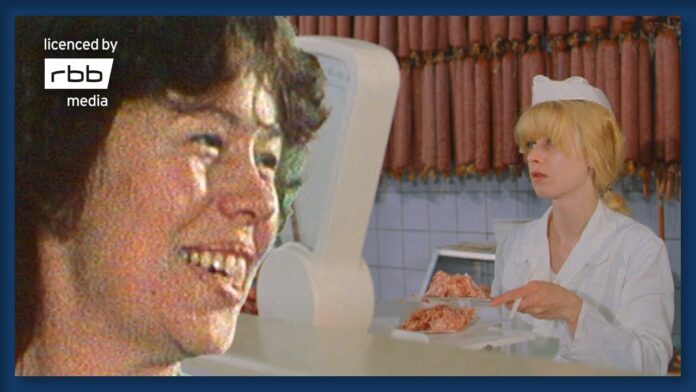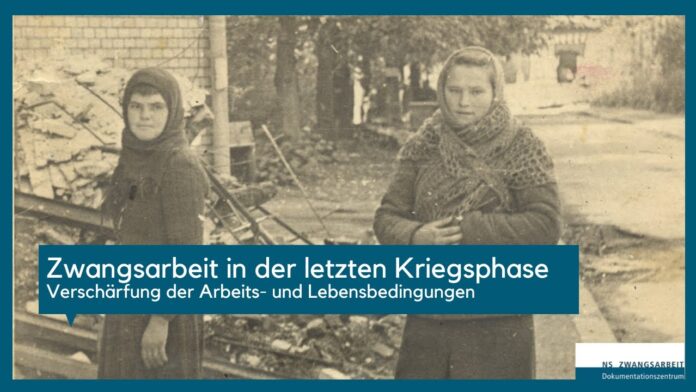Die Berliner Mauer, von der DDR-Führung einst als „antifaschistischer Schutzwall“ bezeichnet, sollte die Bürger im Land halten. Doch gegen den unbändigen Wunsch nach Freiheit erwiesen sich Beton, Stacheldraht und Minen als zu schwach. Menschen riskierten ihr Leben, um dem System ein Schnippchen zu schlagen, und bewiesen dabei außergewöhnlichen Mut, Frechheit und Cleverness. Ihre Geschichten, die oft wie aus einem Spionagefilm anmuten, zeugen von einem unbezwingbaren Freiheitsdrang.
Die Berliner Mauer, von der DDR-Führung einst als „antifaschistischer Schutzwall“ bezeichnet, sollte die Bürger im Land halten. Doch gegen den unbändigen Wunsch nach Freiheit erwiesen sich Beton, Stacheldraht und Minen als zu schwach. Menschen riskierten ihr Leben, um dem System ein Schnippchen zu schlagen, und bewiesen dabei außergewöhnlichen Mut, Frechheit und Cleverness. Ihre Geschichten, die oft wie aus einem Spionagefilm anmuten, zeugen von einem unbezwingbaren Freiheitsdrang.
Der gewagte Fotograf: Horst Bayers Mauer-Shooting Am 9. Oktober 1961, dem 12. Jahrestag der DDR, wählte ein Mann den wohl dreistesten Weg in die Freiheit: der Fotograf Horst Bayer. Bayer, bekannt als Lebemann mit lockeren Sprüchen, passte ohnehin nicht ins System. Ausgerechnet er wurde auserkoren, Fotos von der Mauer für die Jubelfeiern zu machen, was ihm den Zutritt zum Grenzbereich ermöglichte – eine Einladung zur Flucht, die er nicht ignorieren konnte.
Mit seiner Kamera und einigen jungen Sportlerinnen des SV Rotation Berlin, die er die Mauer als „Freund“ und „Beschützer“ preisen ließ, inszenierte er ein scheinbar harmloses Fotoshooting. Während er Aufnahmen von den jungen Frauen machte, die sich an der Mauer räkelten und Blumen an die „heldenhaften Grenzsoldaten“ überreichten, führte er diese geschickt ab. In einem unbeobachteten Moment wechselte er die Seite. Die Grenzer bemerkten den Schwindel erst, als es zu spät war. Horst Bayer hatte es geschafft – ein cleverer Bürger weniger für die DDR. Im Westen fotografierte er später für die Bildzeitung und blieb ein lebenslustiger Mensch.
Mutterliebe im Einkaufstrolley: Annelise Trauzettels List 26 Jahre später, 1987, bewies Annelise Trauzettel, eine Frührentnerin, dass Mutterliebe die höchste Mauer ist. Obwohl sie als Frührentnerin jederzeit nach West-Berlin durfte, musste ihr vierjähriger Sohn Mike immer in der DDR bleiben. Die Behörden drohten sogar mit Zwangsadoption. Doch Annelise gab nicht auf.
Ihr Plan war ebenso einfach wie genial: Sie wollte Mike in einem Einkaufswagen durch alle Kontrollschleusen des Grenzbahnhofs Friedrichstraße schmuggeln. Wochenlang trainierte sie mit Mike das Versteckspiel im Wagen und sorgte sogar für Beruhigungsmittel, damit die Flucht für ihn „wie im Schlaf“ ablief. Um die Spürhunde der Grenzposten zu täuschen, sprühte sie Mike zuvor mit Deospray ein. Auf dem belebten Bahnhof, einem Labyrinth aus Kontrollen und Soldaten, navigierte sie den Trolley geschickt durch die Massen. Als ein Stasi-Mann ihren Wagen kontrollieren wollte, rief sie laut: „Spinnt du, du Depp! Weg!“ und wurde von einem Passanten geschützt. Die Notbremse einer U-Bahn gab ihr schließlich die entscheidende Zeit, um zu entkommen. Annelise Trauzettel, ausgestattet nur mit Mut, Mutterliebe und einem alten Trolley, überlistete das System.
Die Betke-Brüder: Schwimmen, Seil und Luftschlag Die Brüder Ingo, Holger und Egbert Betke wurden zu einer wahren „Plage für das DDR-System“. Ihre Fluchten sind ein Paradebeispiel für Zusammenhalt und Einfallsreichtum.
- Ingos Elbe-Flucht: Als ältester der Brüder und Anführer der „Gang“, nutzte Ingo sein Wissen aus dem Militärdienst über Grenzbefestigungen, um eine lebensgefährliche Flucht durch Stacheldraht, Minenfeld und die Elbe zu planen. Mit einem „Stampfer“ bahnte er sich einen Weg durch das Minenfeld und überwand die Elbe auf einer Luftmatratze, obwohl die Strömung viele in den Tod gerissen hatte. Er paddelte „wie ein Geisteskranker“, während Patrouillenboote die Gefahr erhöhten. Nach seiner erfolgreichen Flucht sollte es 15 Jahre dauern, bis er seine Eltern wiedersah.
- Holgers Drahtseilakt: Acht Jahre später folgte der jüngste, Holger, ein Mann des Nervenkitzels. Seine Idee war es, die Mauer aus einer „ganz anderen Perspektive“ zu betrachten: von oben. Zusammen mit seinem Freund Michael Becker wählte er ein Haus an der Ostseite der Mauer und planten einen Drahtseilakt. Ihr Plan war, mit einem Flitzebogen eine dünne Angelschnur über die Mauer zu schießen, um daran das dickere Drahtseil zu befestigen. Nach mehreren Fehlversuchen gelang es schließlich. Ingo spannte das Seil von der Westseite aus, und Holger rutschte in die Freiheit. Die Grenzer waren auf einen solchen „Drahtseilakt“ einfach nicht gefasst.
- Der Luftschlag für Egbert: Die Betkes ließen nicht locker. Um ihren dritten Bruder Egbert zu befreien, ersannen sie einen weiteren spektakulären Plan: Sie wollten ihn mit einem Ultraleichtflugzeug ausfliegen. Das Problem: Sie konnten noch nicht fliegen. Zwei Jahre lang übten sie das Starten und Landen in der Eifel. Am 25. Mai 1989 war es so weit. Holger und Ingo flogen mit getarnten Flugzeugen, versehen mit Russensternen, um nicht sofort beschossen zu werden, von West-Berlin nach Treptow, um Egbert abzuholen. Nach einer holprigen Landung und einem schnellen Einstieg starteten sie zu dritt, wobei die Maschine nun 80 kg schwerer war. Sie landeten direkt vor dem Reichstag. Egbert war zutiefst gerührt über das, was seine Brüder für ihn riskiert hatten. Die Betkes haben die DDR „locker überlebt“, denn „Einigkeit macht eben stark“.
Der Zug in die Freiheit: Harry Detterlings Coup Ebenfalls zu den spektakulären Fluchten gehört der Coup von Lokführer Harry Detterling und Heizer Hartmut Lichi. Am 5. Dezember 1961 durchbrachen sie mit dem Vorortzug „Lok 234“ die Absperrungen an der Grenze zu West-Berlin und brachten 25 Menschen in die Freiheit. Detterling, der sich weigerte, die Teilung Deutschlands zu unterschreiben, bereitete seine Flucht akribisch vor. Er täuschte einen Sinneswandel vor, meldete sich zu Sonderschichten an und überzeugte seine Vorgesetzten, ihn auf die gesicherte Strecke fahren zu lassen. Ohne die Fahrgäste zu informieren, beschleunigte der Zug kurz vor der Grenze. Obwohl es bei einer Kontrolle im Zug Probleme gab und Rufe wie „Anhalten, anhalten, wohin wollt ihr!“ erklangen, reagierten Detterling und Lichi nicht. Sie durchbrachen alle Sperren und erreichten Spandau. Die „Lok 234“ machte Harry Detterling zu einem Helden der 60er Jahre.
Das Erbe der Frechheit Diese Geschichten zeigen, dass die höchste Mauer gegen eine gute Idee Mut, Frechheit und Cleverness sind. Die Menschen, die dem System ein Schnippchen schlugen, ob durch einen Zug, einen Einkaufswagen, eine Elbe-Durchquerung, einen Drahtseilakt oder ein Ultraleichtflugzeug, demonstrierten, dass der menschliche Wille zur Freiheit nicht eingesperrt werden kann. Ihre Taten bleiben unvergessen und sind ein Zeugnis außergewöhnlichen Einfallsreichtums im Angesicht der Unterdrückung.