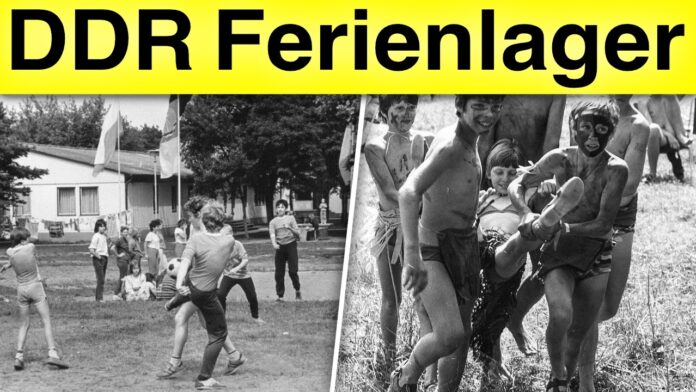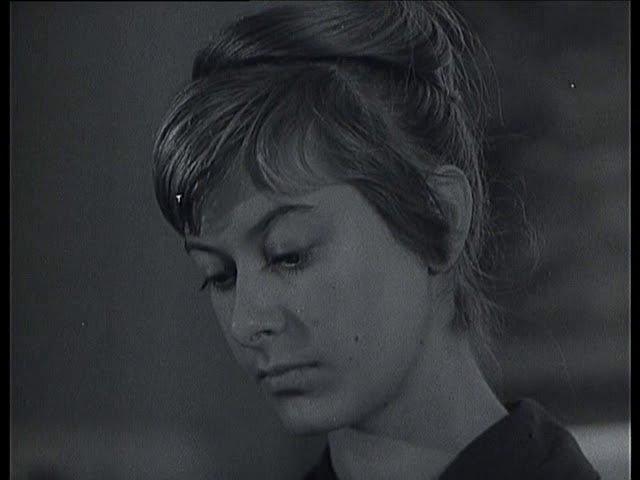Brandenburg, Anfang der 1980er Jahre. In einem unscheinbaren Försterhaus, 70 Kilometer östlich von Berlin, trafen sich Gäste, deren Identität und Aufenthalt bei Bekanntwerden eine schwere internationale Krise zwischen Ost- und Westdeutschland ausgelöst hätte. Es waren Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF), einer terroristischen Organisation, die in der Bundesrepublik Deutschland Angst und Schrecken verbreitete und für mindestens 34 Morde sowie über 200 Verletzte verantwortlich gemacht wird. Doch was verband die meistgesuchte Terrorgruppe Westdeutschlands mit dem ostdeutschen Staatssicherheitsdienst, der Stasi?
Geburt des Terrors aus Enttäuschung und Ideologie
Die RAF, 1970 gegründet von Persönlichkeiten wie Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof, entwickelte sich aus einer Generation junger Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1960er Jahren eine tiefe Enttäuschung über die Nachkriegsgesellschaft ihrer Eltern empfanden. Entsetzt über den Vietnamkrieg der USA und mit einer großen Kluft zu den älteren Generationen, die das deutsche Wirtschaftswunder aufgebaut hatten, suchten sie nach Alternativen. Der Marxismus, wenn auch nicht in seiner sowjetischen Form, wurde zur Blaupause für eine revolutionäre Gesellschaft.
Ein entscheidender Faktor in Deutschland war das Scheitern der Entnazifizierung, das dazu führte, dass ehemalige Nationalsozialisten weiterhin wichtige Positionen in Regierung und Wirtschaft innehatten. Die RAF verstand sich als kommunistische und antiimperialistische Guerillagruppe, die das kapitalistische System – welches sie als Fortsetzung des Faschismus betrachtete – stürzen und eine revolutionäre, antiimperialistische, marxistische Gesellschaft errichten wollte.
Die Geschichte der RAF wird oft in drei Generationen unterteilt:
• Die erste Generation (1970-1977), zu der die Gründer gehörten, war für die bekanntesten Anschläge verantwortlich, darunter die „Mai-Offensive“ von 1972 mit sechs Anschlägen, der tödlichste war der Bombenanschlag auf die Campbell Barracks in Heidelberg, bei dem drei US-Soldaten getötet wurden.
• Die zweite Generation (1977-Anfang der 1980er Jahre) entstand nach den Verhaftungen und Todesfällen der Gründungsmitglieder. Sie intensivierte die Gewalt, verübte hochkarätige Attentate, Bombenanschläge und Entführungen, darunter die Ermordung von Hanns Martin Schleyer, um die Freilassung inhaftierter Mitglieder zu erzwingen.
• Die dritte Generation (Anfang der 1980er Jahre-1991) agierte verdeckter und professioneller, mit weniger prominenten ideologischen Motiven. Sie konzentrierte sich auf symbolische Ziele, einschließlich der Ermordung hochrangiger Persönlichkeiten aus Industrie und Sicherheit.
Die geheime Hand der Stasi
Obwohl die Deutsche Demokratische Republik (DDR) offiziell den Terrorismus ablehnte, unterstützte sie die RAF. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), bekannt als Stasi, begann schon kurz nach der Gründung der RAF mit deren Beobachtung. Die Stasi ermöglichte es der ersten Generation der RAF-Mitglieder, die zu den meistgesuchten Personen Westdeutschlands gehörten, von Ost-Berlin aus in den Nahen Osten zu reisen.
Ende der 1970er Jahre führten interne Spannungen und ideologische Meinungsverschiedenheiten in der RAF nach dem Tod der Gründer dazu, dass einige Mitglieder der Gewalt abschworen. Die RAF suchte nach Ländern, in denen ehemalige Mitglieder sicher leben konnten, und die Stasi bot ihre volle Unterstützung an: neue Identitäten, Wohnungen und Arbeitsplätze in der DDR. Acht RAF-Terroristen erhielten unter dem Codenamen „Operation Stern“ neue Namen, Geburtsdaten und Hintergrundgeschichten und wurden zu „inoffiziellen Mitarbeitern inoffizieller Leitung“, was bedeutete, dass sie ihr neues Umfeld bespitzeln mussten.
Für die Stasi bot diese Allianz mehrere Vorteile: Solange RAF-Mitglieder in der DDR waren, musste sie keine Angst vor RAF-Anschlägen haben. Zudem wusste die aktive RAF, dass ihre ehemaligen Genossen nicht plötzlich an die Öffentlichkeit gehen würden. Die Stasi war über laufende Ermittlungen des BKA gut informiert und hatte sogar Agenten im Bundesamt für Verfassungsschutz. Einmal half die Stasi der RAF, zu überprüfen, ob eine Kontaktperson ein westdeutscher Agent war; im Gegenzug erhielt die Stasi die vollständigen Akten einer US-Militärbasis in Westdeutschland.
In den 1980er Jahren erhielten RAF-Mitglieder in der DDR auch militärisches Training. Es ist bekannt, dass Christian Klar, der 1981 auf US-General Frederick Kroesen schoss und ihn nur knapp verfehlte, in der DDR im Umgang mit der verwendeten sowjetischen Panzerfaust ausgebildet wurde, wobei unklar ist, ob dies vor oder nach dem Anschlag geschah. Die Stasi war definitiv an der Vorbereitung dieses Anschlags beteiligt.
Mitte der 1980er Jahre verdächtigten westdeutsche Geheimdienste, dass RAF-Mitglieder in der DDR lebten. Drei wurden identifiziert, blieben aber unter Stasi-Schutz, die großen Aufwand betrieb, um deren Tarnung aufrechtzuerhalten, inklusive neuer Wohnorte, Identitäten und sogar Schönheitsoperationen. Doch die Risiken wurden der Stasi zu groß, und sie hörte auf, weitere RAF-Mitglieder aufzunehmen.
Nach dem Mauerfall: Das Ende einer Ära
Mit dem Fall der Mauer wehte ein anderer Wind in Deutschland. Im Juni 1990, kurz vor der deutschen Wiedervereinigung, wurden alle ehemaligen RAF-Mitglieder in der DDR verhaftet. Sie konnten leicht aufgespürt werden, da die Behörden die Melderegister überprüften und nach Personen suchten, die neu in die DDR gekommen waren. Innerhalb eines Tages wurden alle RAF-Mitglieder in Ostdeutschland lokalisiert und innerhalb der nächsten zwei Wochen festgenommen. Die RAF löste sich offiziell 1998 auf.
Die Unterstützung der Stasi reichte möglicherweise über die Wiedervereinigung hinaus. Bei der Ermordung von Alfred Herrhausen, dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank, im November 1989, wurde eine hochentwickelte Autobombe eingesetzt, was auf spezialisierte Fähigkeiten hindeutete und Unterstützung, möglicherweise aus dem Nahen Osten, vermuten ließ. Am 1. April 1991, im vereinigten Deutschland, wurde Detlev Rohwedder, der Chef der Treuhandanstalt zur Privatisierung der ostdeutschen Staatsbetriebe, von einem Scharfschützen erschossen. Die RAF bekannte sich dazu. Es wurde nie bewiesen, aber es ist möglich, dass ehemalige Stasi-Agenten involviert waren und der Schütze seine Ausbildung und Waffe über Kontakte aus dem ehemaligen Stasi-Netzwerk erhielt. Rohwedders Ermordung war der letzte gezielte RAF-Mord.
Trotz ihrer Unterschiede teilten die RAF und die DDR eine antikapitalistische, marxistisch-leninistische Ideologie, antifaschistische Rhetorik und die Überzeugung, auf der richtigen Seite der Geschichte gegen kapitalistische Ausbeutung zu stehen. Der Leiter der Stasi, Erich Mielke, sah die RAF-Terroristen als „Waffenbrüder“ und plante, sie im Konfliktfall für Sabotageakte im Westen einzusetzen. Es ist nicht vollständig klar, wer in der ostdeutschen Führung außer Mielke und dem damaligen DDR-Staatschef Erich Honecker über diese Verbindungen Bescheid wusste. Doch ihre Hilfe trug dazu bei, dass die RAF länger aktiv bleiben konnte, als es sonst der Fall gewesen wäre.
Die heimliche Unterstützung der RAF durch die Stasi bleibt ein dunkles Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte, das die tiefe Spaltung und die ideologischen Konflikte des Kalten Krieges auf erschreckende Weise beleuchtet.