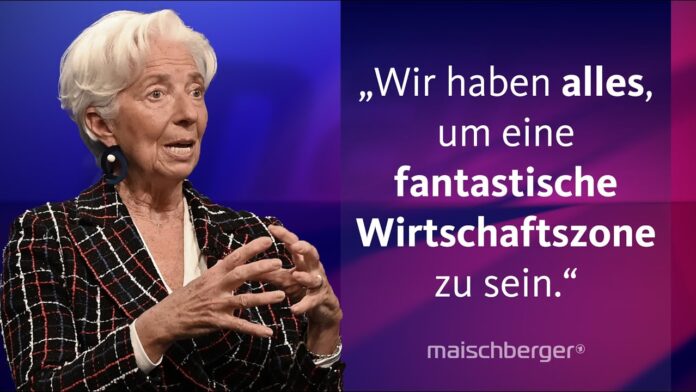Warnemünde. Das Hotel Neptun, ein Wahrzeichen an der Ostseeküste, eröffnete 1971 und galt schnell als Aushängeschild der DDR-Hotellerie. Unter der langjährigen Leitung von Klaus Wenzel entwickelte es sich von einem Devisenhotel zu einem Fünf-Sterne-Wellnessrefugium, das Gäste aus Ost und West anzog. Doch hinter dem Glanz und der scheinbaren Gastfreundschaft verbarg sich ein tiefgreifendes System der Überwachung durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), das bis heute den Ruf des Hauses als „Stasi-Hotel“ prägt.
Schon früh rankten sich Gerüchte um das markante Gebäude in Warnemünde. Die Geschichte des Hotels ist untrennbar mit Klaus Wenzel verbunden, der es über Jahrzehnte führte und 2003 sogar zum Hotelier des Jahres gekürt wurde. Doch die glänzende Fassade des Erfolgsmanagers und seines Vorzeigehotels zerbrach angesichts der Enthüllungen über die tiefgreifenden Verstrickungen mit dem DDR-Geheimdienst.
Ein engmaschiges Netz: Über 100 Inoffizielle Mitarbeiter im Einsatz
Die Stasi unterhielt im Hotel Neptun ein als „perfektes Netz“ beschriebenes System von Inoffiziellen Mitarbeitern (IM). Akten der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen belegen, dass weit über 100 IMs über die Jahre im Hotel tätig waren. Das Hotel bot eine ideale Plattform für die Stasi, da es ein Treffpunkt für Menschen aus Ost und West war und regelmäßig von Politikern und Geschäftsleuten frequentiert wurde.
Zu den Schlüsselfiguren dieses Netzwerks zählten hochrangige Mitarbeiter des Hotels:
Hans-Jürgen Cemag (IM „Neptun“): Als Kaderleiter und Personalchef (IM „Neptun“ seit 1967) sicherte Hans-Jürgen Cemag die Einstellung „linientreuen“ Personals. Der ausgebildete HVA-Ermittler erhielt Prämien, beispielsweise für die Rücknahme von Ausreiseanträgen durch Angestellte.
Klaus Urban (IM „Schreier“): Der Gastronomiechef und langjährige Weggefährte Wenzels war ebenfalls seit 1967 als IM tätig. Seine Aufgaben umfassten Beobachtungen und Ermittlungen im Hotel.
Thomas Klippstein (IM „Benjamin“): In den 1980er Jahren verpflichtete sich der junge Empfangssekretär aus Überzeugung und unentgeltlich zur Mitarbeit. Er lieferte Berichte über Kollegen sowie Gäste und sammelte noch im Oktober 1989 Informationen über Sympathisanten des Neuen Forums. Nach Bekanntwerden seiner Tätigkeit, die er bedauerte und für die er sich entschuldigte, wurde er als späterer Direktor des Hotel Adlon in Berlin von seinen Aufgaben entbunden.
Günther Knoblauch (IM „Achim“): Der stellvertretende Hoteldirektor erhielt Prämien für operative Aufgaben im westlichen Ausland und ist bis heute Wenzels Stellvertreter.
Bernd Schröder (IM „Heinisch“): Zunächst Chef der Sky Bar, später Empfangschef, unterstützte er die Stasi bei der Auswahl abhörgeeigneter Zimmer. Er ist heute noch Empfangsdirektor.
Dietmar Hansen (IM „Rolf“): Als Cheftechniker für die Kommunikationsanlagen war er eine Schlüsselperson. In seiner Akte fanden sich Quittungen für Prämien für Raumüberwachung und Telefonanzapfungen. Er soll nach der Wende die Anlagen nach Wanzen durchsucht haben.
Diese tief in den Hotelbetrieb integrierten IMs konnten Gäste von der Begrüßung bis zur Verabschiedung begleiten und überwachen. Bemerkenswert ist, dass die IMs oft nichts voneinander wussten und sich teilweise gegenseitig bei der Stasi denunzierten.
Der Direktor im Zwielicht: Klaus Wenzel als IM „Wimpel“
Lange gab es nur Indizien, doch spätere Recherchen förderten zwei Bände der Arbeitsakte von IM „Wimpel“ zutage. Diese belegen eindeutig, dass Klaus Wenzel unter diesem Decknamen vom MfS geführt wurde. Die Akten enthalten Treffberichte zwischen Wenzel und seinem Führungsoffizier in Wenzels Dienstzimmer im Hotel. Für seine Tätigkeit erhielt Wenzel offenbar Auszeichnungen und Prämien. Es gibt zudem Hinweise, dass er auch für die Auslandsaufklärung (HVA) tätig war, was seine besondere Stellung unterstreicht. Klaus Wenzel lehnt Interviews zu diesen Vorwürfen kategorisch ab.
Lückenlose Überwachung: Wanzen, Kameras und Abhörzentralen
Das menschliche Spitzelnetz wurde durch eine lückenlose technische Überwachung ergänzt: Wanzen zur Raumüberwachung und angezapfte Telefonleitungen waren derart Standard, dass unmittelbar nach der Wende die gesamte Telefonanlage ausgetauscht werden musste.
Verdeckte Videokameras, installiert unter anderem am Seiteneingang, über dem Haupteingang und der Bibliothek, überwachten Aufzüge und die Rezeption. Jede Ecke der Lobby konnte observiert werden, ohne dass die Gäste davon ahnten. Ein geheimer Vertrag zwischen dem MfS und der Hoteldirektion, unterzeichnet von Klaus Wenzel, regelte diese Videoüberwachung. Hoteltechniker waren teilweise an der Installation beteiligt. Eine Diplomarbeit der Stasi-Hochschule nannte das Neptun als Musterbeispiel für den Einsatz operativer Fernsehtechnik. Die Signale wurden an verschiedene Punkte im Hotel und später in das gegenüberliegende Kurhaus übertragen, von wo aus Stasi-Mitarbeiter die Gäste beobachteten.
Gäste im Fadenkreuz: Von Journalisten bis zu Spitzenpolitikern
Die Stasi zeigte reges Interesse an den Hotelgästen, insbesondere jenen aus dem Westen. Treffen von West-Gästen mit Ost-Verwandten vor dem Hotel wurden fotografiert. Westliche Journalisten standen unter Beobachtung. Besuche prominenter West-Politiker wie Björn Engholm lösten großangelegte Operationen aus („Maßnahmeplan Aktion Küste“), an denen bis zu sieben MfS-Abteilungen beteiligt waren. Weibliche Spitzel wurden in Hotelbars auf ihn angesetzt. Uwe Barschel, ein Stammgast, feierte seinen 40. Geburtstag im Hotel, während am Nebentisch als Ehepaar getarnte IMs jedes Wort mithörten. Selbst bei einem US-amerikanischen Diplomaten wurde 1988 das volle Überwachungsprogramm aktiviert, inklusive Wanzen, Zimmerdurchsuchungen und Geruchsproben. Getarnte Beobachtungsposten in Autos oder Strandkörben umgaben das Hotel.
Devisenbeschaffung und KoKo-Verbindungen
Ursprünglich als Devisenhotel konzipiert, erzielte das Neptun hohe Einnahmen in harter Währung, die an die Kommerzielle Koordinierung (KoKo) unter Alexander Schalck-Golodkowski abgeführt wurden. Wenzel erhielt Planvorgaben direkt von der KoKo. Ab 1980 musste das Hotel jedoch 80% seiner Zimmer für DDR-Urlauber des FDGB reservieren, die für zwei Wochen nur 310 DDR-Mark zahlten. Dies schmälerte die Deviseneinnahmen erheblich. Um den Schwarztausch einzudämmen, führte Wenzel das „Neptun Geld“ ein, das Westgäste in ihrer Landeswährung erwerben mussten. Das Hotel diente zudem als Drehscheibe für diverse Geschäfte, von Schiffs- und Waffenhandel bis zu Antiquitäten. Der Hamburger Geschäftsmann Peter Lüdemann, ein wichtiger IM der HVA (IM „Kaufmann“), war ein häufiger Gast.
Das Erbe der Stasi: Aktenvernichtung und ungeklärte Fragen
Im Herbst 1989 gab es massive Versuche, Stasi-Akten zu vernichten. Obwohl die Besetzung der Stasi-Zentrale in Rostock dies teilweise verhinderte, wurden viele Akten zum Hotel Neptun vernichtet; zahlreiche Ordner waren leer.
Nach der Wende wurde das Hotel an die libanesisch-amerikanische Gruppe Kabila Ameropa verkauft. Der Verkauf des Hotels nach der Wende an die libanesisch-amerikanische Gruppe Kabila Ameropa befeuerte Spekulationen: Kabila Ameropa unterhielt bekanntermaßen enge Geschäftsbeziehungen zur HVA-gesteuerten Firmengruppe FC Gehrlach, die schon zuvor an den undurchsichtigen Geschäften des Neptun beteiligt war und davon profitierte. Klaus Wenzel behielt weiterhin Einfluss und sitzt heute im Aufsichtsrat der Arkona AG, zu der das Hotel gehört.
Fortwährendes Schweigen und die Last der Vergangenheit
Auch Jahrzehnte nach der deutschen Einheit ist die vollständige Aufarbeitung der Geschehnisse im Hotel Neptun nicht abgeschlossen. Viele Akten sind unbearbeitet, vieles wurde vernichtet. In Rostock herrscht eine spürbare Zurückhaltung, das Thema anzusprechen. Die Konfrontation mit der tiefen Durchdringung der DDR-Gesellschaft durch Verrat und Denunziation, die bis in die Hotelküche reichte, ruft schmerzhafte Erinnerungen hervor. Scham, Angst und ein geringes Aufklärungsinteresse prägen den Umgang mit dieser Vergangenheit. Die Furcht vor einflussreichen Personen wie Klaus Wenzel scheint fortzubestehen, ein Zeichen dafür, dass viele Aspekte der DDR-Zeit und der Rolle des Hotel Neptun nie vollständig aufgeklärt wurden. Es wirkt, als habe die Revolution diesen Teil des Strandes ausgelassen, ein vergessenes Stück DDR. Eine lückenlose Aufklärung, so die dringende Einschätzung, bleibt jedoch Utopie, solange nicht alle Beteiligten ihr belastendes Schweigen brechen und sich der verdrängten Wahrheit stellen.