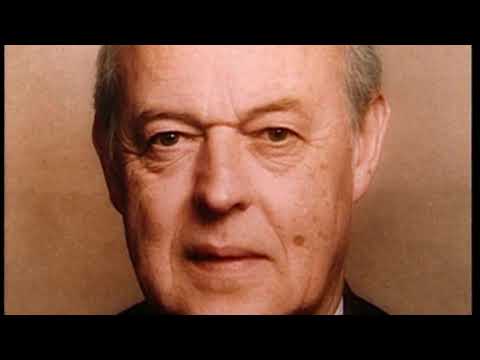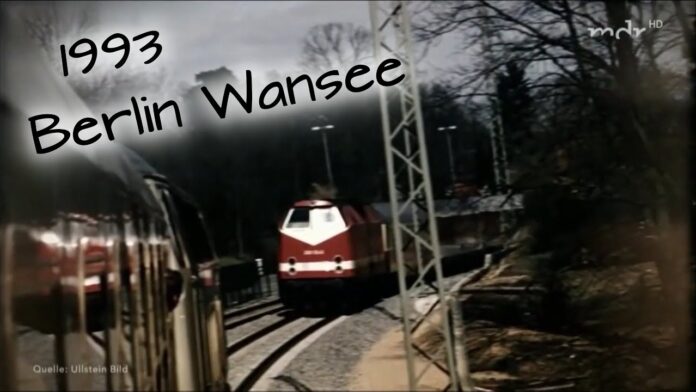In einer Anhörung im Landtag hat Professor Stefan Homburg von der Leibnitz Universität Hannover eine grundlegende Kritik an der deutschen Corona-Politik geäußert. Der Experte, der seit über 30 Jahren als Sachverständiger für Bundestag und Landtage tätig ist, vertritt die Kernthese, dass in der Coronakrise „zu viel“ getan wurde. Seiner Meinung nach lag die Ursache des Fehlers darin, dass klinische Messwerte über drei Jahre hinweg in der politischen Diskussion ignoriert wurden. Stattdessen habe sich die Politik an Labordaten, wie PCR-Werten, und an Computersimulationen orientiert, anstatt an tatsächlichen Messwerten, was zu einer Überreaktion führte.
Homburg untermauert seine These mit vier zentralen Belegen:
• Belegung der Intensivbetten: Daten des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) zeigen, dass die Intensivstationen in Deutschland von 2021 bis 2025 stets zu etwa 85% belegt waren, was den Empfehlungen entspricht. Auffällig sei eine Unterbelegung im Jahr 2020, als Operationen politisch untersagt wurden, was viele Kliniken in Not brachte und ein milliardenschweres Subventionsprogramm erforderte. Homburg hebt hervor, dass die oft gezeigte „dramatische“ gepunktete Linie der PCR-positiven Patienten, die sowohl an Covid Erkrankte als auch z.B. Unfallopfer umfasste, nie mit der klinisch relevanten Linie der tatsächlichen Intensivbelegung verglichen wurde, die stabil verlief.
• Sterblichkeitsentwicklung: Die Grafik der wöchentlichen Todesfälle in Deutschland seit 2008 zeigt ein auffälliges Wellenmuster mit mehr Todesfällen im Winter. Homburg betont, dass die von der WHO definierte Pandemiezone (orange markiert) visuell nichts Besonderes darstellt, wenn man die Farbe wegließe. Eine höhere Sterblichkeit gab es Ende 2022 und insbesondere im März 2018 während einer starken Grippewelle, die die Sterblichkeit Ende 2020 (Coronawelle) übertraf.
• Zulassungsstudie von Pfizer: Homburg kritisiert die Fehlinterpretation der Ergebnisse dieser riesigen Studie mit 43.000 Patienten. Er legt dar, dass der Impfstoff zwar signifikant vor einem positiven PCR-Test plus Erkältungssymptom schützte (die oft zitierten 90-95%). Jedoch wurde ein Schutz vor Übertragung überhaupt nicht getestet. Homburg betont dies als besonders erwähnenswert, da Maßnahmen wie 2G/3G, einrichtungsbezogene Impfpflicht und die knapp gescheiterte allgemeine Impfpflicht ausschließlich auf der Behauptung basierten, der Impfstoff biete Schutz vor Übertragung, was nie bewiesen wurde. Der Schutz vor schwerer Erkrankung war in der Studie nicht signifikant, und es gab in der Impfgruppe mehr Tote als in der Kontrollgruppe sowie gehäuft Myokarditis-Nebenwirkungen. Das Experiment sei im Grunde gescheitert, doch die Politik habe eine Notzulassung erteilt, den Hersteller von der Haftung ausgeschlossen und die Studie entblindet, was sie de facto zerstört habe.
• Wirksamkeit der Maßnahmen im internationalen Vergleich: Unter Bezugnahme auf eine WHO-Studie, die in Nature veröffentlicht wurde, verglich Homburg die Übersterblichkeit in etwa 100 Ländern. Er hob hervor, dass Schweden, wo es nie einen Lockdown, kaum Kitaschließungen, wenig Schulschließungen (nur in oberen Klassen) und keine Maskenpflicht gab, wesentlich besser abschnitt. Dies widerlege die Annahme, Deutschland sei nur wegen der Maßnahmen glimpflich davongekommen.
Wie es besser gemacht werden kann – Homburgs Empfehlungen:
Homburg gab konkrete Ratschläge für die Zukunft, um eine Wiederholung solcher Fehler zu vermeiden:
1. Keine Politik nach Laborwerten: Er zeigte auf, wie winzige PCR-Wellen zu drastischen Maßnahmen wie dem ersten Lockdown oder der Bundesnotbremse führten, während viel höhere Inzidenzen im Sommer 2022 ohne Konsequenzen blieben.
2. Transparenz schaffen: Die Coronakrise sei eine Geschichte von „Löschen, Pimpen und Canceln“ von Daten. Als Beispiel nannte er die Stadt Weimar, die 2021 aufhörte, die Zahl der geimpften Klinikpatienten anzugeben, mit der Begründung, dies „verzerrt die Realität“ und spiele „Coronaleugnern in die Hände“.
3. Keine politische Willkür: Interne RKI-Protokolle, die durch einen Whistleblower bekannt wurden, belegen, dass Risikobewertungen des RKI auf politischen Weisungen beruhten und nicht auf fachlichem Rat. Beispiele sind die politische Ablehnung einer Reduzierung des Risikos im Hochsommer 2020 und im Februar 2022, oder dass das RKI die Beendigung der Pandemie durch den Minister aus der Zeitung erfuhr.
4. Fake News ignorieren: Homburg widerlegte die „Bergamo-Geschichte“ von Lastwagen voller Leichen als Legende, die selbst vom bayerischen Rundfunk widerlegt wurde. Es handelte sich um 13 Särge, die zu einem Krematorium gefahren wurden, da in Italien die Verbrennung unüblich ist und die Kapazitäten in Bergamo damals überlastet waren. Er wies darauf hin, dass die Aussage, eine weltweite Pandemie führe zu vielen Toten in nur einer Stadt, widersprüchlich sei.
5. Pandemieplan beachten: Homburg appellierte an die Abgeordneten, den Nationalen Pandemieplan Teil 1 zu beachten, der medizinisches Wissen aus Jahrzehnten enthält und vom RKI veröffentlicht wurde, aber komplett ignoriert wurde. Begriffe wie Schulschließungen, Ausgangssperren oder Lockdown stünden darin nicht und seien auch nicht medizinisch empfohlen oder in WHO-Leitlinien oder Lehrbüchern zu finden gewesen, sondern von der Politik „oktroyiert“ worden. Er ermutigte Brandenburg, sich zukünftig nicht politisch in Berlin „anklemmen“ zu lassen, sondern auf eigenes Urteilsvermögen zu setzen.
Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen aus Sicht der Krankenhäuser:
Abschließend ging Homburg auf das zentrale Thema der Verhältnismäßigkeit ein und bezog sich dabei auf Ausführungen eines Vorredners:
• Schließung ambulanter Praxen: Diese schlossen aus Angst, befeuert durch das „Schockpapier“ des Bundesinnenministeriums, das von Nichtmedizinern verfasst wurde und z.B. beschrieb, dass Kinder ihre Eltern töten könnten. Dies sei ein erstes Beispiel für Unverhältnismäßigkeit.
• „Freihaltung“ von Betten: Die politische Entscheidung, Operationen monatelang nicht zuzulassen, obwohl keine Patienten kamen, führte zu Problemen in den Kliniken, die durch Milliarden vom Bund abgefedert werden mussten, war aber unverhältnismäßig.
• Kinderbetreuung: Kitaschließungen waren für die Mitarbeiter der Krankenhäuser extrem problematisch und absolut unverhältnismäßig.
• Verlust von Mitarbeitern: Auch die Politik, symptomlos positiv getestete Mitarbeiter vom Dienst auszuschließen, war unverhältnismäßig.
Homburg schloss mit der Feststellung, dass es den Krankenhäusern und indirekt auch den Patienten insgesamt besser gegangen wäre, wenn die Politik verhältnismäßiger reagiert hätte.