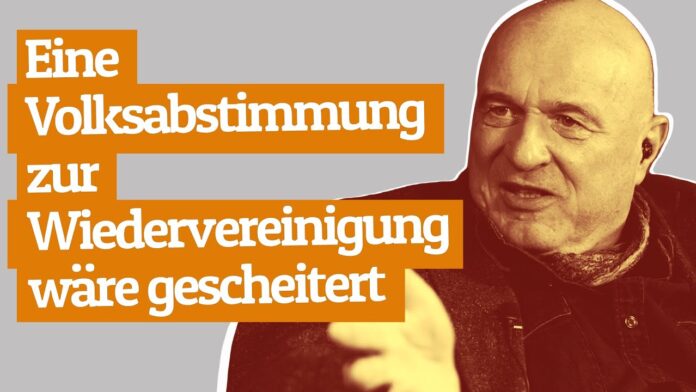Berlin – Mario Röllig, dessen Fluchtversuch aus der DDR im Jahr 1987 scheiterte und der daraufhin drei Monate im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen inhaftiert war, engagiert sich heute in zahlreichen Projekten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und ist Vorsitzender der Lesben und Schwulen in der Union in Berlin. Seine Geschichte ist ein Zeugnis persönlicher Freiheit und des unermüdlichen Kampfes gegen Unrecht.
Ein „normales“ Leben mit Einschränkungen
Vor seinem Fluchtversuch führte Mario Röllig ein Leben, das er als „ganz normal“ beschreibt, wie das Millionen anderer DDR-Bürger und Jugendlicher. Doch dieses Leben war von den Restriktionen des sozialistischen Staates geprägt. Obwohl er das Abitur anstrebt hatte, war die Möglichkeit dazu stark reglementiert: In einer Klasse von 30 Schülern durften nur vier die Erweiterte Oberschule besuchen, und Röllig gehörte nicht zu den Auserwählten. Die Auswahl bevorzugte junge Menschen mit „regimetreuer“ Einstellung, deren Eltern oft in Fabriken arbeiteten, um die Arbeiterklasse zu fördern.
Sein Vater riet ihm zur Gastronomie, wo er die Möglichkeit sah, „viel Geld zu verdienen“. Röllig fand einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz im Flughafen Berlin-Schönefeld, das damals als „Tor zur Welt“ galt. Obwohl er sich selbst als unpolitisch einschätzte, wusste er aus dem Alltag heraus, dass er mit Gästen nicht über Politik, schon gar nicht kritisch, sprechen durfte, da „immer Menschen im Umfeld, Kollegen oder andere Leute im Restaurant, die große Ohren bekamen und zuhörten“, dies weiterleiten könnten.
Die Liebe als Auslöser der Flucht
Der Wendepunkt in Rölligs Leben kam mit seinem Coming-out als schwuler Mann im Alter von 16 Jahren. Er verliebte sich 1985 auf einer Urlaubsreise nach Budapest in einen Mann aus West-Berlin. Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen, als sein Freund ihn regelmäßig in der DDR besuchte, wurde die Stasi auf sie aufmerksam. Viele uniformierte Grenzbeamte waren Stasi-Leute, die genau prüften, wer ein- und ausreiste.
Im November 1986 wurde Röllig von zwei Männern des Ministeriums für Staatssicherheit in das Büro seines Chefs im Flughafenrestaurant zitiert.
Sie waren mit seiner Arbeit zufrieden, wollten ihn aber als Informanten anwerben, um Informationen über seinen West-Berliner Freund zu sammeln – dessen Schwächen, Stärken, Charakter, politische Einstellungen und Freundeskreis. Mario Röllig weigerte sich, Freunde zu verraten, „und schon gar nicht die erste große Liebe“.
Die Stasi reagierte mit Druck: Sie wussten über seinen Führerscheinantrag, die zehnjährige Wartezeit auf einen Trabant und seine Hoffnung auf eine eigene Wohnung, für die Singles in Ost-Berlin acht Jahre warten mussten. Sie versprachen ihm ein neues Auto innerhalb von drei Wochen und die freie Wahl des Wohnbezirks in Berlin, wenn er kooperiere. Röllig provozierte sie mit der Forderung nach einer Wohnung in „West-Berlin Charlottenburg“ – eine absolut tabuisierte Antwort.
Drei Wochen später verlor er seinen Arbeitsplatz und wurde zum Hilfsarbeiter als Abwäscher am S-Bahnhof Berlin-Schöneweide degradiert. Die Stasi drohte ihm, dass er bis zum Ende seines Lebens abwaschen müsse, wenn er nicht kooperiere, und bei einmaligem Zuspätkommen als „arbeitsscheu und asozial“ verhaftet würde. Diese Drohungen verstärkten seine Angst und trieben ihn in die Flucht.
Obwohl Homosexualität in der DDR gesetzlich entkriminalisiert war (Paragraph 175 wurde entschärft), war sie in der Bevölkerung nicht anerkannt, und die Gründung offizieller Selbsthilfegruppen war verboten.
Der missglückte Fluchtversuch
Mario Röllig plante seine Flucht im Alleingang, niemandem erzählte er davon. Er flog 1987 für seinen Jahresurlaub nach Budapest und fuhr per Anhalter in den Süden Ungarns, um Polizeikontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln zu vermeiden. Er versteckte sich in einem Graben an der Grenze zu Jugoslawien, sah aber aus 150 Metern Entfernung stündlich patrouillierende ungarische Armeepolizei. Sein Plan war, nach Einbruch der Dunkelheit loszurennen, was er auch tat.
Doch er hatte nicht mit den bitterarmen Bauern im Süden Ungarns gerechnet, die im Nebenberuf Kopfgeldjäger für das Regime waren – selbst für Tote gab es Geld. Röllig hörte Schreie, einen Schuss und rannte um sein Leben. Kurz vor den letzten Grenzschildern rutschte er aus und wurde gefasst. Er musste miterleben, wie der Kopfgeldjäger für seine Verhaftung ein Bündel Geldscheine erhielt, was er heute als über einen halben Monatslohn beziffert.
Die Haft: Psychische Tortur statt körperlicher Gewalt
Nach seiner Festnahme wurde Röllig zunächst in einer Zelle in der Grenzstation und dann in Gefängnisse in Kecskemét und Budapest gebracht. Er nahm in einer Woche etwa zehn Kilo ab, da die hygienischen Bedingungen und das Essen unerträglich waren.
Nach einer Woche wurde er mit anderen jungen DDR-Flüchtlingen von zivilen Stasi-Leuten in einem Sonderflugzeug nach Berlin-Schönefeld zurückgebracht. Röllig musste vor dem Flug eine Beruhigungstablette einnehmen, um gewaltsame Spritzen zu vermeiden. In Berlin angekommen, wurde er in einem fensterlosen Containerwagen – beschrieben als „Besenschrank große dunkle Zellen“ – nach Hohenschönhausen transportiert. Dort erlebte er eine entwürdigende Ankunft: unter Gebrüll und Geschrei wurde er aus dem Wagen gezerrt, umringt von Männern mit Gummiknüppeln. Er musste sich an eine Wand stellen, Hände hinter den Kopf, Gesicht zur Wand, Schnürsenkel und Gürtel abgeben – eine Szene, die ihn an einen Nazi-Film erinnerte und ihm das „letzte Rest Heimat“ nahm.
In Hohenschönhausen erhielt er die Gefangenen-Nummer 328. Seine Zelle war zwar sauber, aber die Heizung lief im Hochsommer auf Hochtouren, wodurch die Temperatur 35 bis 40 Grad erreichte. Er wurde tagsüber ständig durch den Türspion beobachtet.
Die Vernehmungen waren eine psychologische Tortur. Der erste Vernehmer schrie ihn an und beleidigte ihn als „schwules asoziales Element“. Der zweite, über Monate zuständige Vernehmer war gegensätzlich: freundlich, gepflegt, auf sein Persönlichkeitsbild angesetzt. Dieser Vernehmer eröffnete ihm, er könne mit zwei bis acht Jahren Haft rechnen, möglicherweise mit 15 Mördern in einer Zelle, was für ihn als schwulen Mann „bestimmt nicht angenehm“ wäre. Ihm wurde vorgeworfen, das Vaterland verraten, den Weltfrieden gefährdet und einen Atomkrieg provoziert zu haben. Die Stasi bot ihm an, seine Strafe zu reduzieren, wenn er andere aus seinem Umfeld belastete. Um niemanden zu verraten, zählte Röllig stundenlang die Blätter der Wandtapete.
Körperliche Folter fand in Hohenschönhausen zu dieser Zeit nicht mehr statt; stattdessen wurde hauptsächlich „seelisch gefoltert“. Dies lag daran, dass die DDR Gefangene an den Westen verkaufte, um Devisen zu erhalten – 90.000 bis 120.000 D-Mark pro Person in den 1980er Jahren – und die Freigelassenen im Westen keine Folterspuren zeigen sollten.
Die wundersame Freilassung und der Weg in die Freiheit
Nach nur drei Monaten wurde Mario Röllig entlassen – sein „größtes Glück“. Die DDR war Ende 1987 wirtschaftlich „völlig pleite“ und brauchte dringend Geld. Rölligs Name wurde im Westen bekannt. Seine Eltern, die er zutiefst stolz nennt, weigerten sich, jeden Kontakt zu ihm abzubrechen, wie es von einer „sozialistischen Familie“ erwartet wurde. Stattdessen informierten sie heimlich Freunde in West-Berlin. Diese Freunde kontaktierten ein prominentes Rechtsanwaltsbüro, das wiederum beste Kontakte zum innerdeutschen Ministerium der Bundesregierung hatte. So kam Röllig auf die geheime Freikaufsliste der Bundesrepublik Deutschland für politische Gefangene. Er wurde ohne Gerichtsprozess oder Urteil, aber mit einem Amnestie-Beschluss entlassen.
Obwohl seine Eltern ihn mit offenen Armen empfingen, musste er noch vier Monate als Hilfsarbeiter abwaschen. Er nahm bewusst an Veranstaltungen der Opposition teil, was der Stasi reichte, um ihn als „gefährlich“ und „ohne Angst“ einzustufen. Am 7. März 1988 wurde er von der Stasi zum Bahnhof gebracht und in einen Zug gesetzt. Die Stasi drohte ihm, ihn wieder zu verhaften, sollte er um Mitternacht noch auf DDR-Staatsgebiet sein, und warnte ihn davor, öffentlich über seine Erlebnisse zu sprechen, da ihm überall etwas zustoßen könnte und seine Eltern bekannt seien. Am 8. März 1988, punkt 0 Uhr nachts, fuhr der Zug mit Mario Röllig über die deutsch-deutsche Grenze in die Freiheit. Dies war der schönste Augenblick seines Lebens.
Der Schatten der Vergangenheit: Begegnung mit dem Vernehmer und die Folgen
Jahre später, 1997, arbeitete Röllig als Verkäufer in der Zigarrenabteilung des Berliner KaDeWe. Dort traf er zufällig seinen ehemaligen Stasi-Offizier, der ihn über Monate verhört und seelisch gefoltert hatte. Der Vernehmer, der ihn nicht erkannte, kaufte teure Zigarren. Röllig sprach ihn an, stellte sich vor und forderte eine Entschuldigung. Der Vernehmer reagierte mit Schreien und der Aussage, Röllig sei damals zu Recht in Haft gewesen und es gäbe keinen Grund zur Reue.
Dieses Erlebnis stürzte Mario Röllig in eine tiefe Krise mit Depressionsschüben, Angstattacken und Panikzuständen. Er versuchte, sich das Leben zu nehmen, wurde aber gerettet. Ein Chefarzt diagnostizierte ein Foltertrauma. Er riet Röllig, die Gedenkstätte Hohenschönhausen, das ehemalige Gefängnis, zu besuchen und seine Geschichte zu erzählen, um zu heilen. Dies tut Röllig seit 22 Jahren, um sicherzustellen, dass das Thema nicht vergessen wird.
Ein weiterer Schlag war die Einsicht in seine Stasi-Akten im Jahr 1997, die 2000 Seiten umfassen. Das Schlimmste war nicht die Verhörprotokolle, sondern die Erkenntnis, wer ihn alles verraten hatte: Nachbarn, wenige Arbeitskollegen und vor allem sein damaliger bester Freund. Bei einem Treffen in einem Berliner Café, als Röllig seinen Freund zur Rede stellte, wies dieser jede Schuld von sich. Seitdem haben sie sich nie wiedergesehen. Das Vertrauen ist bis heute ein schwieriges Thema für Röllig, auch in Freundschaften und Beziehungen, da er stets die Angst trägt, zu viel von sich preiszugeben und verraten zu werden.
Nach dem Mauerfall und die Vision für die Zukunft
Den Mauerfall erlebte Mario Röllig in West-Berlin. Sein Vater rief ihn mitten in der Nacht aus Ost-Berlin an, um ihm die Nachricht zu überbringen. Röllig, zunächst ungläubig, eilte zum Grenzübergang Bornholmer Straße, wo er seine Eltern nach fast zwei Jahren wiedertraf. Doch die Freude war gemischt: Er empfand auch Wut, da die Mauer ihn nicht nur von seiner Familie getrennt, sondern ihn im Westen auch „geschützt“ hatte. Nun musste er all jene wiedersehen, die ihm das Leben in der DDR so schwer gemacht hatten.
Mario Röllig engagiert sich in der CDU, da er sie als einzige Partei sieht, die sich offensiv mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur auseinandersetzt. Er betont die Förderung von Gedenkstätten und Zeitzeugenprojekten, die seit Angela Merkels Kanzlerschaft stärker geworden sei.
Für die heutige Ost-West-Beziehung plädiert er für gegenseitiges Zuhören und Besuche, um Stereotypen wie „Besserwessis“ oder „40 Jahre SED gewählt“ abzubauen. Für junge Generationen sei die Ost-West-Frage heute ohnehin kein Thema mehr.
Freiheit bedeutet für Mario Röllig, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich einzumischen und nicht nur zu meckern. Er mahnt: „Deshalb seit unbequem, stellt Fragen, lasst euch nicht alles bieten und hinterfragt auch selbst unsere demokratische Bundesregierung“. Seine Geschichte ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass Demokratie niemals selbstverständlich ist und ständiges Engagement erfordert, um nicht eines Morgens in einer Diktatur aufzuwachen.