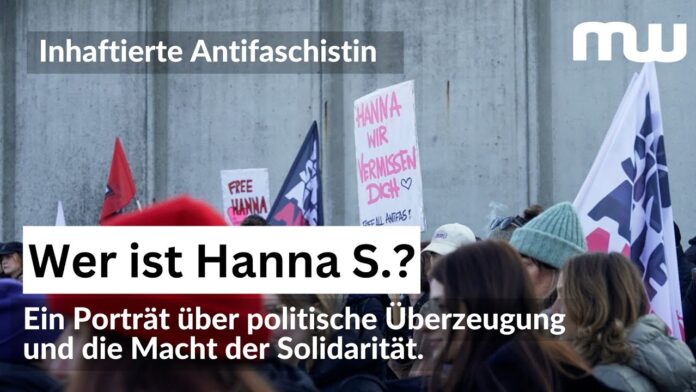Nürnberg/München – Der Fall der Kunststudentin Hanna S., die derzeit im sogenannten „Budapest-Komplex“ in München angeklagt ist, hat sich zu einem Brennpunkt der Diskussion über staatliche Repression und die Rolle des Antifaschismus in Deutschland entwickelt. Ihr Prozess beleuchtet nicht nur die spezifischen Vorwürfe gegen sie, sondern auch grundsätzliche Fragen zum Umgang der Justiz mit politischem Aktivismus.
Der „Tag der Ehre“ und die Auseinandersetzungen in Budapest
Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen Ereignisse, die sich im Februar 2023 in Budapest zugetragen haben. Dort findet jährlich der sogenannte „Tag der Ehre“ statt – eines der größten neonazistischen Events in Europa, bei dem Hunderte und Tausende Neonazis zusammenkommen, um an einem „Reenactment“ eines versuchten Ausbruchs von SS-Soldaten und ungarischen Faschisten im Zweiten Weltkrieg zu gedenken. Dieses Treffen dient gleichzeitig als Vernetzungsplattform für die europäische extreme Rechte.
Seit Jahren kommt es im Umfeld dieses Events zu antifaschistischen Gegenprotesten. Im Jahr 2023 gab es dabei körperliche Auseinandersetzungen. Während die ungarische und deutsche Staatsanwaltschaft davon ausgehen, dass Antifaschistinnen gezielt rechtsextreme Teilnehmerinnen in koordinierten Gruppen angriffen, sprechen Aktivist*innen von ungeplanten Auseinandersetzungen. Recherchen von Antifa-Gruppen zufolge waren die angegriffenen Personen „relativ hochrangige und gut organisierte Neonazis“, darunter Laszlo Dudoc, ein Mitglied von Blood and Honor in Ungarn, und Personen aus der Gruppierung Legio Ungaria, die bereits durch Angriffe auf Synagogen und jüdische Menschen auffiel.
Schwere Vorwürfe und kritische Stimmen der Verteidigung
Hanna S., eine Kunststudentin aus Nürnberg, wurde im Mai 2024 in Nürnberg festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ihr werden im Zusammenhang mit den Budapester Ereignissen gefährliche Körperverletzung, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und, was als besonders kritisch angesehen wird, versuchter Mord vorgeworfen.
Hannas Anwalt, Yunus Ziyal, weist insbesondere den Vorwurf des versuchten Mordes entschieden zurück. Er betont, dass der Geschädigte „innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen wieder komplett genesen“ war, es sich lediglich um „Platzwunden und Prellungen“ handelte. Der Mordvorwurf sei die „schärfste“ Anschuldigung, die das deutsche Strafgesetzbuch kennt, und lasse sich angesichts der Art und Weise, wie Antifaschist*innen agieren, schwer rechtfertigen. Es sei weder aus der Geschichte noch aus der jüngeren Vergangenheit abzuleiten, dass es die Absicht von antifaschistischen Aktionen sei, Nazis zu töten. Selbst die Generalbundesanwaltschaft gehe davon aus, dass die Taten dem Muster der sogenannten „Antiverst“ folgten, bei denen es explizit um Körperverletzungshandlungen ging, die nach einer bestimmten Zeit abgebrochen und nicht auf die Tötung des Gegners abzielten.
Hanna als Künstlerin und Aktivistin
Hanna S. wird als engagierte Studentin und Aktivistin beschrieben, die sich „stellvertretend für den Einsatz gegen Ungerechtigkeiten und den Rechtsdruck in unserer Gesellschaft“ einsetzt. Als Kunststudentin an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg war sie „total darauf fokussiert, dass man sich einbringt und guckt, dass diese Gemeinschaft läuft“. Thematisch fließen gesellschaftspolitische und politische Themen in ihre Arbeiten ein. Eine ihrer Arbeiten, „Wir dürfen niemals vergessen 2023“, basierte auf dem Buch „Kein Vergessen“ von Thomas Billstein, das die Todesopfer rechter Gewalt seit 1945 dokumentiert. Hanna schuf dafür Papierkarten, auf denen jedes Loch für ein Jahr und jeder Knoten für ein Lebensjahr eines Opfers rechter Gewalt stand, um der „Masse an Daten“ ein Gesicht zu verleihen und zur Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen. Hätte man all diese Karten an einer Wand präsentiert, so bräuchte man „über 100 Meter von der Wand“.
Der Umgang der Justiz – Zwischen Dämonisierung und Skandal
Der Umgang der Justiz mit dem Fall wird von den Unterstützer*innen Hannas als „Kriminalisierung von praktisch gewordenem Antifaschismus“ und „Dämonisierung“ bezeichnet. Es wird kritisiert, dass das Verfahren in einem Hochsicherheitssaal verhandelt wird, der eigentlich für Terrorverfahren gebaut wurde und direkt an die JVA München angeschlossen ist. Dies werde mit Sicherheitserwägungen und der „breiten Solidarisierung“ gerechtfertigt.
Besonders hervorzuheben ist die Art der Festnahme: Hanna wurde mit einem „wahnsinnig großen Polizeiaufgebot“, das ganze Straßenzüge absperrte, aus ihrer Wohnung abgeführt. Ihre Untersuchungshaft wird als fragwürdig empfunden, da sie an ihrem Wohnort anzutreffen war und kein Fluchtrisiko bestand. Die Vermutung, sie sei eine „Terroristin“, die „schlimmer als der IS“ sei, machte in der Haftanstalt die Runde, und Vergleiche zu Beate Zschäpe wurden gezogen. Diese Dämonisierung, so ein Sprecher des Solikreises Nürnberg, „setzt ja letztenendes diese ganze Dämonisierung und hier den Eindruck von dem Terrorverfahren eigentlich einfach fort“.
Die Verteidiger*innen befürchten zudem, dass die Verfahren in Ungarn nicht nach rechtsstaatlichen Bedingungen ablaufen und die Haftbedingungen katastrophal sind, mit Berichten über Bettwanzen, mangelhaftes Essen und schlechte Hygiene. Im Fall der Antifaschistin Maja, die trotz eines Eilantrags ans Bundesverfassungsgericht in Windeseile nach Ungarn ausgeliefert wurde, um effektiven Rechtsschutz auszuhebeln, sprechen die Quellen von einem „Justizskandal“. Maja musste unter katastrophalen Bedingungen leiden, wobei ihre Rechte als nonbinäre Person in einem „autoritären, rechtskonservativ regierten transfeindlichen System“ Ungarns nicht gewahrt wurden. Diese rechtswidrige Auslieferung wurde inzwischen vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, doch ihre Rückholung gestaltet sich schwierig. Die Sorge vor einer ähnlichen Auslieferung hing lange wie ein „Damoklesschwert“ über Hanna.
Es wird die Frage aufgeworfen, warum ein „sehr viel höherer Ermittlungseifer“ bei politisch linken Aktivistinnen an den Tag gelegt wird als bei rechten Gewalttätern. Das Oberlandesgericht München begründet die Härte des Vorgehens gegen Hanna damit, dass ihre vermeintliche Tat „das Ansehen Deutschlands in Gefahr“ sehe. Kritikerinnen entgegnen, dass dies angesichts der Tatsache, dass sich Menschen Faschist*innen entgegenstellen, absurd sei und vielmehr auf den „Stand des Rechtsrucks in Deutschland“ hinweise.
Der Knastalltag und die Kraft der Solidarität
Hanna berichtet selbst über ihren Knastalltag, der von strikten Routinen geprägt ist: Wecken um 6:30 Uhr, Instant-Kaffee, Schreiben, Lesen und eine Folge „Hubert und Staller“ schauen. Sie vermisst vor allem die Freiheit und die Fähigkeit, über sich selbst zu bestimmen. Doch die größte Unterstützung erhält sie durch die breite Solidarität von außen: „Ich habe gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, es waren sicher 100 Postkarten und 30 Briefe, wenn ich sogar mehr“. Diese Unterstützung gibt ihr „die Kraft und den Mut, das hier Stück für Stück durchzustehen“.
Der Film „FREE HANNA – Solidarität im Budapest-Komplex“ versucht, Hanna auch jenseits der Schlagzeilen zu porträtieren und die Macht der Solidarität zu zeigen. Seit Mitte Februar finden an den Prozesstagen in München kontinuierlich Solidaritätsbekundungen statt, oft mit über 100 anwesenden Menschen. Diese breite Unterstützung dient als „Gegenbild zu diesem Versuch der Dämonisierung“ von Antifaschist*innen als „besonders gefährliche Subjekte“. „Solidarität ist die stärkste Waffe, die die Menschen generell, die keine Macht haben, haben“, heißt es in der Videoquelle.
Der Fall Hanna S. ist somit mehr als ein individuelles Strafverfahren; er ist eine „Projektionsfläche“ für die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in Zeiten des Rechtsrucks. Er stellt die Frage, ob der Staat zulassen will, dass die Justiz „immer weiter den Fokus nach links richten“ und Widerstand gegen rechte Entwicklungen mürbe machen soll. Für viele ist Hannas Mut zu handeln, selbst wenn die Mittel umstritten sind, ein „Leuchtturm“ in dieser Auseinandersetzung. Praktischer Antifaschismus wird dabei als „nicht nur legitim, sondern auch von Tag zu Tag notwendiger“ angesehen.