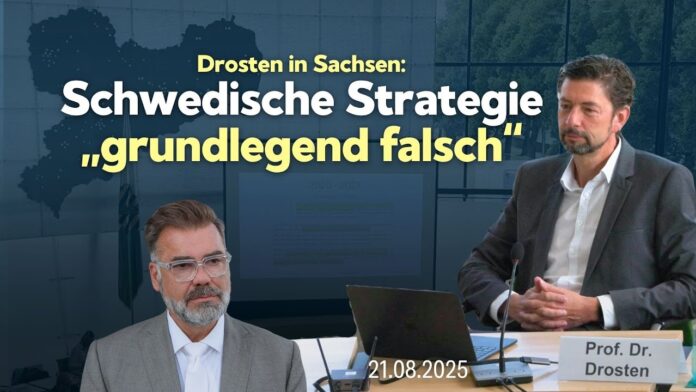Die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik Deutschland war mehr als nur ein Sportereignis; sie war eine Bühne für politische Spannungen, Kalten Krieg und persönliche Schicksale, die sich zwischen Fluchtwunsch und nationaler Rivalität abspielten. Während die westdeutsche Nationalmannschaft sich auf den Titel konzentrierte, planten drei Abiturienten aus der DDR ihre lebensgefährliche Flucht in den Westen, während die Staatssicherheit mit beispielloser Härte gegen sogenannte „Grenzverletzer“ vorging.
Das deutsch-deutsche Duell: Sport vor politischem Hintergrund Die Auslosung der Gruppen am 5. Januar 1974 in Frankfurt am Main sorgte für ein Raunen im Saal: Die DDR wurde in die Gruppe der BRD gelost. Zum ersten Mal sollten die beiden deutschen Staaten bei einer Fußball-WM aufeinandertreffen, was den Kalten Krieg auf den grünen Rasen brachte. Für Paul Breitner, Torschütze des ersten WM-Tores der BRD und bekennender Kommunist, war es lediglich ein Spiel auf dem Weg zum Titel. Anders für Hans-Jürgen Kreische, den damaligen DDR-Fußballer des Jahres, und viele seiner Kollegen, für die das Duell eine besondere Gelegenheit war, sich mit westdeutschen Spielern zu messen. Sie freuten sich auf die WM und mussten die Auslosung annehmen und das Beste daraus machen.
Die politische Dimension war unverkennbar: Willy Brandt, Kanzler der Bundesrepublik, hatte die DDR als souveränen Staat anerkannt, um die Beziehungen zwischen Ost und West zu verbessern. Doch diese Anerkennung rückte eine Wiedervereinigung in weite Ferne und führte nicht zum Abbau der Grenzanlagen. Im Gegenteil: Die deutsch-deutsche Grenze, seit 1961 von der DDR mit einer Mauer und einem Todesstreifen versehen, wurde Anfang der 70er-Jahre durch die Installation von Selbstschussanlagen, den sogenannten SM-70, noch tödlicher. Diese Geräte waren mit Metallsplittern gefüllt und lösten aus, sobald Flüchtlinge einen dünnen, unsichtbaren Draht berührten, was oft zum Tod führte.
Die Schatten der Stasi: „Aktion Leder“ und die Guillaume-Affäre Parallel zu den WM-Vorbereitungen arbeitete die Staatssicherheit der DDR, unter der Leitung von Erich Mielke, auf Hochtouren, um Fluchtversuche zu vereiteln. Die Aktion „Leder“ war eine der größten Stasi-Maßnahmen der Geschichte: Tausende DDR-Bürger, die zu den WM-Spielen nach Westdeutschland reisen durften, wurden lückenlos überwacht und geschult, wie sie sich zu verhalten hatten. Sogar die eigene DDR-Nationalmannschaft und deren Betreuer, insgesamt 48 Personen, standen unter Beobachtung; Telefone wurden abgehört, Briefe gelesen, und es gab fünf inoffizielle Mitarbeiter (Spitzel) unter den Spielern. Die Stasi war sogar bereit, Sonderaufgaben bis hin zu Attentaten und Mordanschlägen zu veranlassen und plante, flüchtende Spieler mithilfe eines westdeutschen Kriminellen mit dem Decknamen „Rennfahrer“ in einer Holzkiste tot oder lebendig in die DDR zurückzubringen.
Doch die Pläne der Stasi wurden durch einen unerwarteten Zwischenfall erschüttert: Kurz vor der WM wurde ihr Topagent in der BRD, Günter Guillaume, Spion im Bundeskanzleramt und persönlicher Referent Willy Brandts, enttarnt. Die Festnahme Guillaumes belastete das Verhältnis zur DDR schwer und stürzte die Bundesregierung in eine Krise, die zum Rücktritt Willy Brandts führte. Guillaumes Sohn, Pierre Boom, war damals 17 und erlebte die Verhaftung seiner Eltern völlig ahnungslos, während er bis heute nach Antworten auf seine vielen Fragen sucht.
Ein gewagter Plan: Die Flucht der drei Abiturienten Inmitten dieser politischen Turbulenzen reifte der Fluchtplan der drei Abiturienten Bernd Herzog (19), Thomas Röthig (20) und Thomas von Fritsch (19). Sie wollten nicht länger „mit der Lüge leben“, die den Alltag in der DDR bestimmte, und sehnten sich nach Freiheit. Ihr Plan war, nach dem Abitur in den Westen zu gehen. Eine Flucht über Mauer und Todesstreifen kam für Thomas von Fritschs Cousin Rüdiger, der Fluchthilfe leistete, nicht infrage. Stattdessen entwickelte Rüdiger von Fritsch einen kühnen Plan: Er wollte die drei Freunde in Bulgarien treffen und sie dort mit drei gefälschten westdeutschen Reisepässen ausstatten, um sie als „Hippies“ auf dem Weg in die Türkei in den Westen zu schleusen.
Die „Fälscherwerkstatt“ war Rudigers eigenes Werk. Er versuchte sich mühsam an der Kunst des Fälschens, bastelte Einreisestempel mit Radiergummis und einem Federmesser, um die komplexen Details bulgarischer Stempel mit ihren kleinen kyrillischen Buchstaben und Farbverläufen nachzuahmen. Er wusste, dass jeder Fehler das Gefängnis bedeuten könnte. Die letzte Besprechung fand am 26. Mai 1974 in Ost-Berlin statt, wo der Zeitpunkt der Flucht auf das WM-Endspiel am 7. Juli 1974 festgelegt wurde – in der Hoffnung, dass alle Grenzbeamten durch das Spiel abgelenkt wären.
Der tragische Alltag an der Grenze und ein folgenschwerer Fehler Die Grausamkeit des Grenzregimes zeigte sich während der WM auf erschütternde Weise: Am Tag nach dem Auftaktsieg der DDR gegen Australien ertrank der Sohn italienischer Gastarbeiter, Giuseppe Savoca, in der Berliner Spree, da DDR-Grenzpatrouillen nicht eingriffen und Westberliner Retter mit Waffen bedrohten. Auch der 38-jährige Czeslaw Kukuczka wurde bei einem Fluchtversuch getötet, als ein Stasi-Offizier ihm in den Rücken schoss – eine Tat, für die der Schütze einen Orden und eine Beförderung erhielt.
Kurz vor ihrer geplanten Flucht, in der Nacht vor ihrer Abreise, begingen die drei Abiturienten jedoch eine schwerwiegende Dummheit. Bei einem Haldenfest warfen sie ein großes DDR-Emblem aus Holz, Hammer und Zirkel mit Ehrenkranz, ins Lagerfeuer. Dieser „dumme Jungenstreich“ war in der DDR ein Straftatbestand: staatsfeindliche Hetze. Wenn sie verpfiffen würden, wären sie in größter Gefahr.
Die WM 1974 war somit nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern auch ein Zeugnis der tiefen Spaltung Deutschlands und der verzweifelten Suche nach Freiheit im Schatten des Kalten Krieges, dessen Auswirkungen bis in die persönlichsten Lebensbereiche reichten. Die Frage bleibt: Werden die drei Freunde es trotz ihres folgenschweren Fehlers bis nach Bulgarien und von dort in den Westen schaffen?