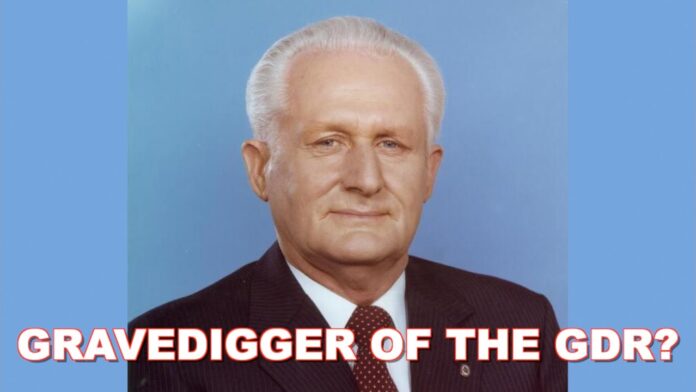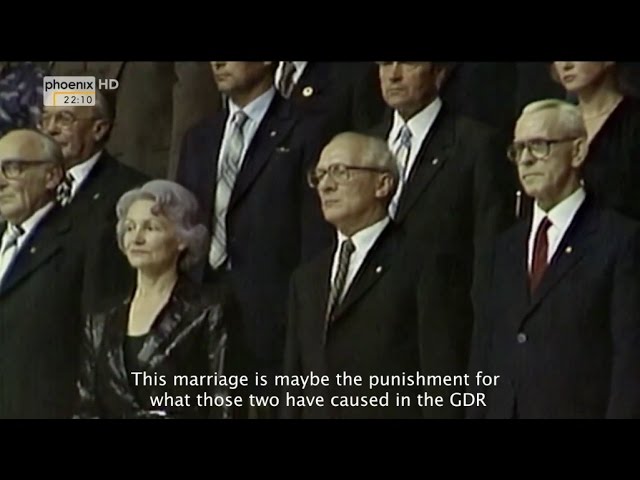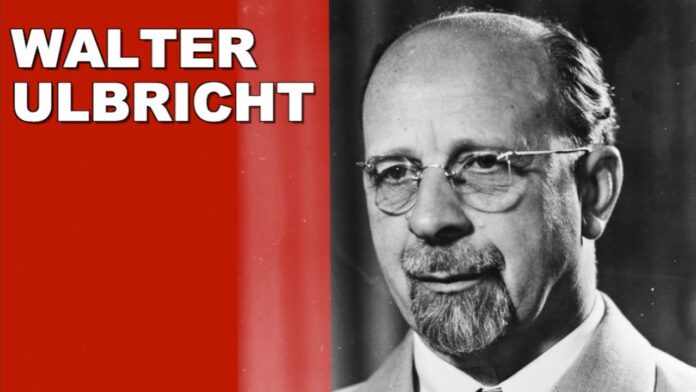Im Herbst 1989, mit dem Fall der Berliner Mauer und der Öffnung der Grenzen zwischen Ost- und Westdeutschland, schien eine Ära zu Ende zu gehen. Während Hunderttausende Ostdeutsche die Freiheit genossen, brach in der Zentrale der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), des Auslandsnachrichtendienstes der DDR, Panik aus. Tausende ihrer Agenten waren noch im Feld, und die HVA befürchtete, deren Anonymität nicht mehr gewährleisten zu können. Man begann fieberhaft, Akten zu vernichten, und es wurde jahrelang angenommen, dass die brisanten Geheimnisse der DDR-Spionage für immer verloren seien. Doch diese Annahme sollte sich als falsch erweisen.
Die Wiederentdeckung und der geheimnisvolle Weg in die USA
Mitte der 1990er-Jahre begannen die CIA, frühere ostdeutsche Agenten in den Vereinigten Staaten festzunehmen, um sie zu neutralisieren und eine mögliche Weiterarbeit für den russischen Geheimdienst zu verhindern. Diese Verhaftungen nährten Gerüchte über die Existenz geheimer Akten, die entgegen aller Annahmen nicht zerstört worden waren. Als sich die Gerüchte als wahr erwiesen, wuchs der Druck auf die Amerikaner, das Material an Deutschland zurückzugeben. Nach jahrelangen Verhandlungen erhielt Deutschland 2003 die auf 381 CD-ROMs gespeicherten Informationen, die fortan als „Rosenhold-Dateien“ bekannt wurden.
Wie die Rosenhold-Dateien ursprünglich in die Hände der Amerikaner gelangten, ist bis heute nicht vollständig geklärt und von Rätseln umrankt. Eine Version besagt, dass ein HVA-Offizier die Dateien an einen CIA-Kontakt verkauft oder sich bestechen ließ. Eine andere Theorie behauptet, HVA-Leutnant Rainer Hehmann sei angewiesen worden, Mikrofilme in Blechdosen an seinen sowjetischen KGB-Kontakt Alexander Principal in Ost-Berlin zu übergeben. Innerhalb des KGB soll dann Oberst Alexander Subeno die Filme an CIA-Oberstleutnant Jim Edward verkauft haben. Beide KGB-Agenten, Principal und Subeno, starben jedoch kurz nach dem Aktenwechsel unter mysteriösen Umständen, was die Wahrheit weiterhin verschleiert. Eine weitere Indikation, dass die Akten möglicherweise ein oder zwei Jahre früher gestohlen wurden, ist das Fehlen von Aufzeichnungen der letzten zwei aktiven Jahre der HVA ab Januar 1988.
Der Inhalt der Rosenhold-Dateien: Einblick in ein Spionagenetzwerk
Die Rosenhold-Dateien sind keine „Schnipsel“, sondern eine umfassende Sammlung von Karteikarten und Datensätzen. Sie enthalten zwei Haupttypen von Karteikarten mit Informationen über die „inoffiziellen Mitarbeiter“ (IM) – die Informanten des ostdeutschen Auslandsgeheimdienstes:
• F-16-Karten (Index der Personen): Diese Formulare enthalten persönliche Daten wie den echten Namen, Geburtsdatum, Nationalität, Adresse, Registrierungsnummer sowie Informationen zur Parteimitgliedschaft, den Arbeitgeber und den Studienort der Person. Von den 293.000 F-16-Formularen erwiesen sich 13.000 als Duplikate. Die überwiegende Mehrheit dieser Karten wurde für Personen erstellt, an denen die HVA aus irgendeinem Grund interessiert war. Enthalten sind die Daten von mehreren Zehntausend inoffiziellen Mitarbeitern in der DDR und rund 6.000 ausländischen Agenten.
• F-22-Karten (Operative Details): Diese Karten enthalten die Decknamen der Agenten, ihre Registrierungsnummern, die Namen ihrer Führungsoffiziere und die Aktennummern aller Fälle der Agenten. Es gibt etwa 57.000 dieser Dateien. Erst wenn eine F-22-Karte mit der richtigen F-16-Karte abgeglichen werden kann, lässt sich der echte Name des Agenten enthüllen.
Leider ist die Sammlung der F-16- und F-22-Karten auf den Rosenhold-CDs nicht vollständig; alle nach Januar 1988 erstellten Karten fehlen.
Zusätzlich enthalten die Rosenhold-Dateien eine dritte Sammlung von Dokumenten: die Datensätze der Agenten. Diese sind unter dem Decknamen des Agenten registriert und detaillieren die Rekrutierung der Person, den Grund für ihren Beitritt, Adresse, Alter, Beruf und welche Spionageausrüstung sie erhalten haben. Jeder Datensatz kategorisiert zudem den Wert des Agenten von „eins“ (geringer Wert) bis „drei“ (höchster Wert und Kontaktperson für Kriegszeiten). Diese Datensätze umfassen nur deutsche Staatsbürger, etwa 1.700 an der Zahl, während Informationen über Nicht-Deutsche von der CIA zurückgehalten wurden. Die Datensätze stammen höchstwahrscheinlich aus einer anderen Quelle und erreichten die USA über einen anderen CIA-Agenten. Sie sind von erheblichem Wert, da sie die Bestätigung der Identität ehemaliger Agenten erleichtern, insbesondere da der Abgleich von F-16- und F-22-Karten durch doppelte Registrierungsnummern und schlechte Scanqualität oft erschwert wurde.
Die Syra-Datenbank: Ein zusätzlicher „Schatz“
Im Jahr 1998 gelang den Mitarbeitern der Stasi-Unterlagenbehörde eine weitere entscheidende Entdeckung: Sie konnten große Teile der sogenannten Syra-Datenbank entschlüsseln. Syra steht für „Informationssystem zur Informationsrecherche der HVA“ und war die ursprüngliche Datenbank des ostdeutschen Geheimdienstes, die 1969 eingerichtet wurde. Diese Datenbank enthält Informationen, die die Agenten der HVA geliefert hatten, und als Bonus auch alle F-22-Karten bis Juni 1989 in besserer Qualität als die Rosenhold-Versionen.
Die Rosenhold-Dateien und die Syra-Datenbank bilden zusammen einen „Schatz“ für detaillierte Recherchen. Sie ermöglichen es, nicht nur „wer wer war“ zu ermitteln, sondern auch „wer was wo, wie und warum“ tat.
Folgen und historische Bedeutung
Der Zugang zu den Rosenhold-Dateien löste eine Welle von Ermittlungen und Verhaftungen aus. Obwohl Tausende von Ermittlungen folgten, führten sie lediglich zu 257 Verurteilungen. Dennoch ermöglichen die Rosenhold-Dateien ein nahezu vollständiges Bild der Stasi-Agenten in der Bundesrepublik Deutschland. Die Enthüllung dieser Daten gilt als eine der bittersten Niederlagen des ostdeutschen Geheimdienstes und lieferte unschätzbare Einblicke in die Methoden der DDR-Spionage.