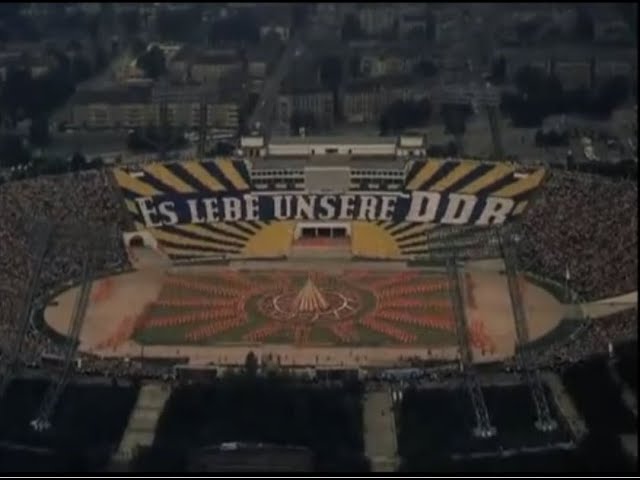In der idyllischen Landschaft Sachsens, nur 9 Kilometer von Döbeln entfernt, liegt Gut Gödelitz – ein Ort, der sich nicht nur als kulturelles Zentrum, sondern auch als geistig-politisches Forum für den Dialog zwischen Ost und West, für Frieden und Verständigung etabliert hat. Die Geschichte des Gutes und der Familie, die es wieder aufbaute, ist eng mit den Idealen und dem Vermächtnis des ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow verwoben, dem kürzlich eine Veranstaltung zu seinen Ehren gewidmet wurde.
Gorbatschows Prägung und sein Kampf für den Frieden
Michail Gorbatschows entschiedene Ablehnung des Krieges wurde tief durch persönliche Erfahrungen geprägt. Als Teenager erlebte er die deutsche Besatzung, Hunger und Demütigung in seinem Dorf. Die Fahrt durch das verwüstete Stalingrad nach dem Krieg, auf dem Weg zum Studium an der Lomonossow-Universität in Moskau, hinterließ bei ihm grauenhafte Bilder der Zerstörung, die sich in sein Gedächtnis einbrannten. Mitte der 1950er-Jahre, als er bereits der Führung des Komsomol in Stawropol angehörte, sah er eine geheime Dokumentation über die Folgen einer Atomexplosion, die ihn zutiefst verstörte. Der Gedanke, „So etwas darf niemals Realität werden“, wurde zu seiner Lebensmaxime. Er war überzeugt: „Wir, ich, wir alle, müssen für den Frieden kämpfen, ernsthaft und mit vollem Einsatz“.
Diese Überzeugung führte ihn später dazu, als Generalsekretär der KPdSU einen Kurs der Perestroika (Umgestaltung) und Glasnost (Offenheit) einzuschlagen. Sein Ziel war die Realisierung politischer Freiheit, Dezentralisierung und, am bedeutsamsten, die Entwicklung des „neuen Denkens“ mit dem Primat der allgemeinmenschlichen Werte. Er strebte die vollständige Vernichtung aller Atomwaffen bis zum Jahr 2000 an und befreite die Welt vor der akuten Atomkriegsgefahr. Für ihn ging es Russland immer um einen angemessenen Platz in einer neuen Sicherheitsarchitektur, nicht um die Wiederherstellung eines sowjetischen Imperiums, eine Behauptung, die er als „dummes Zeug“ abtat.
Herausforderungen im Umgang mit Gorbatschow
Gorbatschows Vision stieß jedoch nicht immer auf uneingeschränkte Unterstützung. So wurde Bundeskanzler Kohl für seine Äußerung in einem US-Magazin, Gorbatschow betreibe nur PR und sei mit Goebbels vergleichbar, kritisiert. Dies empfand Gorbatschow als Beleidigung für sich und sein Land. Die bilateralen Beziehungen auf höchster Ebene wurden daraufhin eingefroren. Hans-Dietrich Genscher spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Beziehungen wieder aufzutauen, indem er dafür plädierte, Gorbatschows Perestroika ernst zu nehmen. Genscher wurde dafür mit Kritik überzogen; es entstand sogar der Begriff „Genscherismus“, der Wachsamkeitsverlust angesichts eines „tückischen Gegners“ bedeutete.
Auch Franz Josef Strauß, ursprünglich skeptisch gegenüber Gorbatschow, entwickelte sich nach mehreren Interviews zu einem „Gorbatschow-Fan“. Der Besuch Gorbatschows in Deutschland im Juni 1989 war ein Schlüsselerlebnis für ihn, da er tief beeindruckt von der Infrastruktur und der warmen Aufnahme durch die Bevölkerung war. Dies trug dazu bei, dass Gorbatschow Deutschland als wichtigsten Partner für seine Reformen ansah.
Das persönliche Vertrauen spielte eine große Rolle. So erinnerte sich Lothar de Maizière, der erste und letzte frei gewählte Ministerpräsident der DDR, an sein erstes Treffen mit Gorbatschow im Kreml. De Maizière überreichte ihm ein Stück Berliner Mauer als Dank für Gorbatschows Worte „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“. Gorbatschow nahm es und fragte: „Sind wir nicht alle zu spät gekommen?“. De Maizière widersprach Gorbatschow auch energisch, als dieser ihn „voll dröhnte“, mit dem Hinweis, die Zeit des „Befehlsempfangs“ sei vorbei, was Gorbatschow anscheinend beeindruckte.
Das Erbe Gorbatschows: Anerkennung und Enttäuschung
Trotz seiner enormen Leistungen, wie der friedlichen Beendigung des Kalten Krieges und der Freilassung ganzer Staaten, erfuhr Gorbatschow besonders in seinen letzten Lebensjahren wenig Anerkennung in Russland. Dort sah man ihn oft als jemanden, der dem Land mehr genommen als gegeben hatte. Auch die deutsche Regierung und Würdenträger zeigten laut einigen Zeitzeugen ein „Armutszeugnis“ im Umgang mit ihm, beispielsweise indem er zu einer Feier zur Deutschen Einheit zunächst eingeladen und dann wieder ausgeladen wurde. Die Chronologie der westlichen Politik, so die Einschätzung, habe maßgeblich den heutigen Putin geschaffen, da man die Jahrhundertgelegenheit einer konstruktiven Einbettung Russlands verpasste.
Gorbatschows persönliche Seite, seine innige Verbindung zu seiner Frau Raisa und seine Fähigkeit, Menschen ernst zu nehmen, selbst ein neunjähriges Mädchen wie Sonja Eichwede, machten ihn zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Er setzte sich kämpferisch für den deutsch-russischen Jugendaustausch ein, da er glaubte, dass sich junge Leute durch persönliches Kennenlernen gegen „dummes Geschwätz“ immunisieren können – ein essenzieller Bestandteil der Friedenspolitik.
Gut Gödelitz: Ein Ort des Dialogs und der Verantwortung
Die Familie Schmidt-Gödelitz, deren Vorfahren 1945 aus Gödelitz fliehen mussten, kehrte nach der Wende zurück und erwarb das Gut. Die Mutter krempelte die Ärmel hoch, während der Vater den Verlust des Gutes nie überwand. Der Wiederaufbau, in den die gesamte Familie ihr Erspartes steckte, war eine große Anstrengung.
Axel Schmidt-Gödelitz gründete 1999 das Ost-West-Forum. Zusammen mit seiner Frau Katrin, die nach der Wende ihren leiblichen algerischen Vater fand und später durch die Heirat nach Gödelitz kam, entwickelte er das „Gödelitzer Modell der Biografiegespräche“. Dieses Projekt bringt Menschen zusammen, um sich ihre Lebensgeschichten zu erzählen und Toleranz zu entwickeln. Es hat sich international etabliert, von Polen bis Korea. Katrin Schmidt-Gürditz, die als Dorfschullehrerin nach Sachsen zog, betont, wie wichtig es ist, dass „Menschen mit Menschen reden, um sich kennenzulernen, um sich zu akzeptieren, um sich zu tolerieren“.
Die Erfahrungen im Ost-West-Forum zeigen jedoch auch die tiefen Gräben, die noch bestehen. Bei einer Veranstaltung, bei der Ost- und Westfrauen über ihre Erfahrungen des Mauerfalls sprachen, gerieten sie so heftig aneinander, dass die Organisatorin bemerkte, die Wunden würden „im Augenblick wieder schlimmer werden“.
Das Gut Gödelitz versteht sich als eine Verantwortung vor jährlich rund 3000 Menschen, die es als geistig-politisches Zentrum besuchen. Die Arbeit ist eine „Selbstausbeutung, aber für einen guten Zweck“.
Gegenrede und das Vermächtnis Egon Bahrs
Ein zentrales Thema in Gödelitz ist die Wichtigkeit der Gegenrede und des Perspektivwechsels. Egon Bahr, politischer Ziehvater von Axel Schmidt-Gödelitz, prägte die Überzeugung, dass Friedensfähigkeit die Fähigkeit voraussetzt, sich in die Schuhe des anderen zu versetzen, dessen Interessen zu erkennen und die Vorgeschichte von Konflikten zu verstehen.
Gabi Krone-Schmalz, eine der Autorinnen des Gorbatschow-Buches und ehemalige ARD-Korrespondentin in Moskau, wurde in Gödelitz empfangen, obwohl sie heute in den Medien als „Putin-Versteherin“ weitgehend ignoriert oder angegriffen wird. Sie kritisiert die Verengung der Diskussion und das Fehlen von Gegenrede in den Medien. Ihre Auftritte in Gödelitz waren sehr erfolgreich, und ihr Plädoyer für eine sachliche, faktenbasierte Analyse statt Ideologisierung oder Moralisierung findet großen Anklang. Die Schwester von Axel Schmidt-Gödelitz, die sich inhaltlich nicht mit Krone-Schmalz versteht, beschreibt den Austausch als zivilisiert und „nahezu liebevoll“, da man Argumente austauscht, ohne persönlich zu werden.
In Zeiten zunehmender Polarisierung bleibt Gut Gödelitz ein Leuchtturm des Dialogs, der das Erbe Gorbatschows und Bahrs weiterträgt: den unermüdlichen Kampf für Frieden, Verständigung und die Fähigkeit, die Perspektive des anderen einzunehmen.