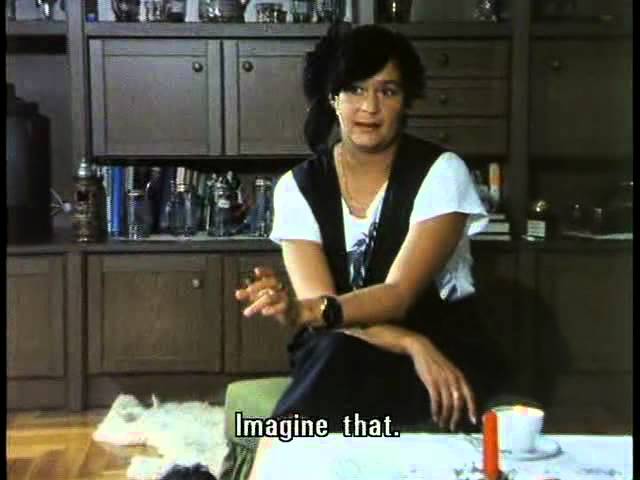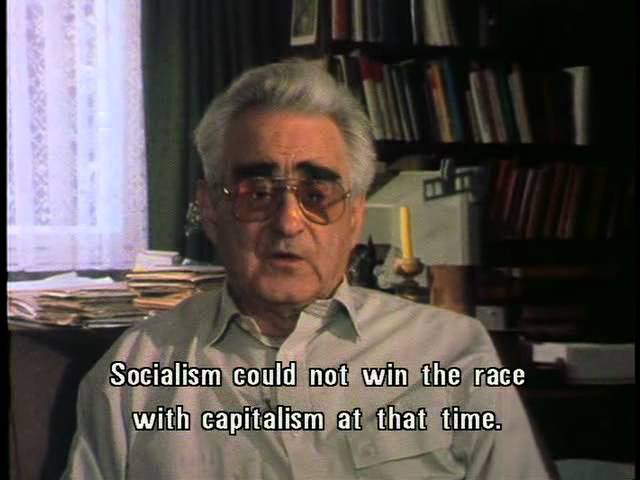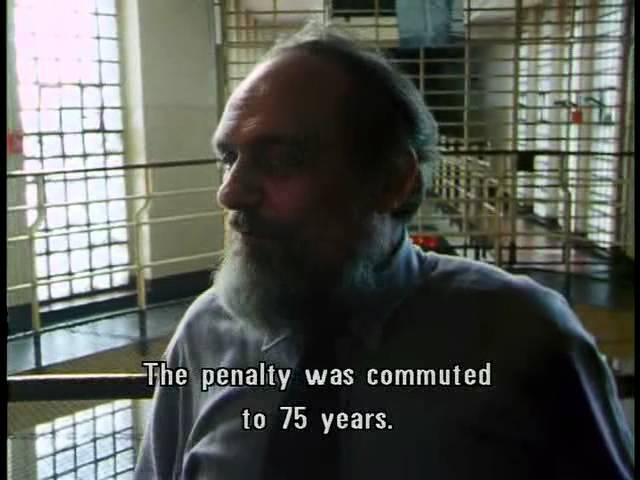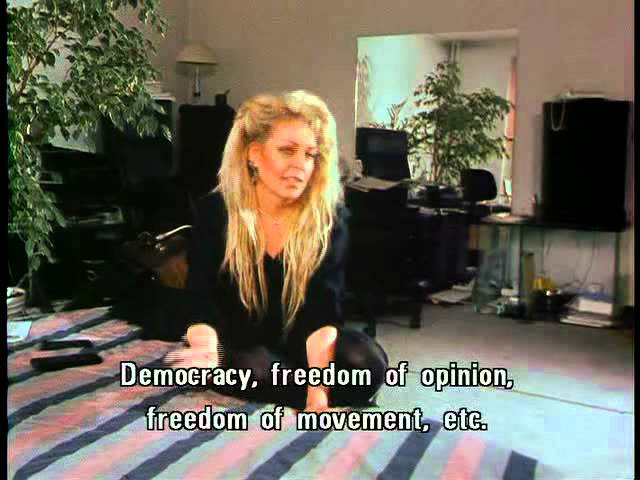Berlin, Deutschland – Das Ende der Deutschen Demokratischen Republik im Spätherbst 1989 wird von vielen als „Wunder“ empfunden. Es war das Ergebnis eines langen politischen Prozesses, der nicht vom Westen initiiert oder unterstützt wurde, sondern allein von den Menschen der ehemaligen DDR getragen wurde. Dieses Wunder hatte jedoch eine lange Vorgeschichte, geprägt von einem unlösbaren Konflikt zwischen dem Versprechen von Sicherheit und der Unterdrückung von Freiheit.
Helsinki 1975: Hoffnung und Keim des Zerfalls
Die Teilnahme an der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Helsinki 1975 wurde von der DDR-Führung als Höhepunkt ihrer Außenpolitik betrachtet. Man hoffte, damit die Spaltung Europas und Deutschlands zu überwinden. Für andere war die Schlussakte von Helsinki der Anfang vom Ende der DDR. Denn mit ihr wurden erstmals die Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenwürde auch für den sowjetischen Machtbereich zum Gegenstand internationaler Verhandlungen. Erich Honecker garantierte seinen Bürgern die Reisefreiheit, die Familienzusammenführung und den Austausch von Kultur und Informationen. Als die Parteizeitung die Schlussakte veröffentlichte, war sie sofort ausverkauft. Viele erkannten: „wenn das verwirklicht wird, was in Korb 3 steht, dann bekommen wir einen ganz anderen Staat, ein ganz anderes Land“.
Die Führung der DDR erkannte zwar, dass viele Menschen das Recht auf Ausreise für sich einfordern würden. Doch die Hoffnung einiger, das Land von innen zu verändern, war ebenfalls groß.
Zwischen Zufriedenheit und Zensur: Die innere Zerrissenheit
1976 erhielten westliche Journalisten erstmals die Möglichkeit, „Man-on-the-Street-Opinion“ in der DDR einzufangen. Während einige Bürger angaben, „sehr zufrieden“ mit ihrem Staat zu sein, weil dieser eine „Friedenspolitik“ betreibe und für die Werktätigen alles tue, äußerten andere den Wunsch nach „Klamotten“ und Reisen in die Bundesrepublik. Manch einer konnte sich bereits damals eine Wiedervereinigung vorstellen: „Das sind alle deutsche Menschen. Warum sollte das nicht anders sein?“.
Doch die Hoffnung auf Reform und Pluralismus wurde schnell zerschlagen. Der SED-Parteitag 1976 verkündete, die „Diktatur des Proletariats ist die höchste Form der Demokratie“. Alternative Ideen, besonders innerhalb der Partei, wurden nicht toleriert. Regimekritiker wie Robert Havemann wurden unter Hausarrest gestellt, und der Ökonom Rudolf Bahro wurde nach der Veröffentlichung seines Buches „Die Alternative“ im Westen zu acht Jahren Haft verurteilt und später ausgewiesen. Auch Künstler wie Wolf Biermann wurden nach Konzerten ausgewiesen, da sie mit ihren Liedern das Regime herausforderten und dessen Schwäche und Angst vor dem eigenen Volk entlarvten. In den ersten drei Jahren nach den Helsinki-Verträgen verließen über 80.000 Menschen die DDR, legal und illegal.
Polnische Solidarität und die Geburt der Friedensbewegung
Die „Panik“ brach 1980 aus, als in Polen die unabhängige Gewerkschaft Solidarność gegründet wurde. Honecker trug sich mit dem Gedanken einer militärischen Intervention, erhielt jedoch keine Unterstützung, da die sowjetische Führung jede militärische Einmischung ausschloss.
Die polnischen Ereignisse inspirierten auch Bürger in der DDR zu zivilem Ungehorsam. Ein Mann befestigte eine polnische Fahne mit der Aufschrift „Solidarität mit dem polnischen Volk“ an seinem Fahrrad, was zu seiner Verhaftung und Verurteilung führte. Während in Westdeutschland Menschen offen ihre Angst vor einem Krieg auf die Straßen trugen, waren in der DDR nur offizielle Proteste erlaubt, die die staatlich verordnete Friedenspolitik unterstützten. Doch die SED fürchtete Ideen, die ihre eigene Definition von Frieden in Frage stellten.
Die Friedensbewegung der DDR forderte ab Anfang der 80er Jahre nicht nur nukleare Abrüstung, sondern klagte auch „innenpolitisch“ fehlende „Freiräume“ ein, was vom Staat „scharf bekämpft“ wurde. Die Jena-Friedensinitiative von 1980 war eine der ersten, die das Prinzip der Öffentlichkeit nutzte, um sich nicht „in kleinen Gruppen zu Hause oder in der Kirche“ zurückzuziehen. Sie arbeiteten eng mit Freunden in West-Berlin zusammen, um über westliche Medien die „Öffentlichkeit“ zu erreichen. Dies führte zu Verhaftungen und Ausweisungen, doch eine „ganz starke Welle von Solidarität im eigenen Land“, besonders aus den Kirchen und Frauengruppen, und auch aus Westdeutschland (z.B. Petra Kelly), trug die Bewegung. Trotz der Angst vor beruflichen Konsequenzen oder der Diskriminierung ihrer Kinder sahen viele den Kampf um Veränderungen als „wichtig“ an.
Wirtschaftlicher Kollaps und Gorbatschows Schatten
Die DDR-Wirtschaft wurde nicht nur durch hohe Militärausgaben, sondern auch durch die Abhängigkeit von sowjetischen Rohstoffen, eine ineffiziente Subventionspolitik und den Verkauf von Qualitätsprodukten zu Schleuderpreisen an den Westen geschädigt. In den frühen 1980er Jahren stand das Land „auf der Brücke der finanziellen Ruine“. Westliche Kredite halfen kurzfristig, doch eine dauerhafte Stabilisierung war nicht mehr möglich. Diese Kredite waren aus westdeutscher Sicht „der erste Schritt, die Abhängigkeit der DDR politisch zur Bundesrepublik bedeutend zu erheben“.
Die wachsende Kluft zwischen der privilegierten Führung und der Bevölkerung zeigte sich immer deutlicher. Massenveranstaltungen wie die Mai-Parade konnten den „riesigen Wandel zwischen den oberen und den unteren nicht verstecken“. In diesem Klima trat Michail Gorbatschow auf die weltpolitische Bühne, um den ökonomischen Verfall im Ostblock durch „Perestroika“ (Umgestaltung) zu reorganisieren. Seine Forderung nach Selbstkritik löste im Politbüro Verwirrung und Unmut aus. Während die SED „Sozialismus in DDR-Farben“ als Antwort propagierte, verdächtigten sie Gorbatschows reformfreudigere Politik. Westliche Staatsmänner wie Helmut Kohl erkannten jedoch die „historische Chance“ in Gorbatschows Politik zur Überwindung der Teilung Europas und Deutschlands.
Im Hintergrund begannen bereits die Vorbereitungen für eine Ära nach Honecker, wobei Moskau mögliche Nachfolger sondierte. Der spätere Putschist Krutschkow, damals stellvertretender Vorsitzender des KGB in der DDR, traf sich mit Hans Modrow, der von Stasi-General Markus Wolf als Gesprächspartner empfohlen wurde.
Der verzweifelte Ruf nach Veränderung
Trotz Honeckers extensiver Auslandsreisen und seines Besuchs in der Bundesrepublik 1987 wuchs der Druck im eigenen Land. Bei Rockkonzerten in West-Berlin, die von Fans im Osten besucht wurden, reagierte die Polizei aggressiv. Die jungen Leute antworteten mit „Gorbi“-Rufen. Die Versuche, der „schmerzhaften Präsenz der Allmächtigen SED zu fliehen“, wurden „immer desperater“.
Etwa 500 Rechtsgruppen veröffentlichten trotz staatlicher Repression ihre Meinungen und schufen eine „Gegenöffentlichkeit“ mit „bescheidenen Mitteln und kleinen Auflagen“, die „von Hand zu Hand“ ging und „Ermutigung“ spendete. Die Entscheidung, das sowjetische Magazin „Sputnik“ zu verbieten, das kritische Debatten über den Stalinismus führte, stieß selbst in SED-Gruppen auf Unverständnis.
Die Idee eines „demokratischen Aufbruchs“ gewann an Fahrt, inspiriert von Polen. Bürgerrechtler forderten geheime Wahlen, um das „von unten“ zu probieren. Bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 wurden die Ergebnisse massiv gefälscht. Viele Bürger, die „auf keinen Fall mit Ja gestimmt“ hatten, wussten: „das wusste jeder, dass das gefälscht sein musste. Da war es dann schon explosiv“.
Tausende flohen über Ungarn und Österreich in den Westen. Das Gefühl, „der Letzte“ zu sein, der in der DDR geblieben war, breitete sich aus.
Die Revolution der Kerzen und der Fall der Mauer
In Leipzig wurde die Nikolaikirche ab 1988 zu einem entscheidenden Treffpunkt für Bürgerrechtler und Ausreisewillige. Jeden Montag um 17 Uhr versammelten sich die Menschen zum Friedensgebet. Trotz der Kenntnis des Massakers auf dem Tiananmen-Platz in China, das die Brutalität staatlicher Gewalt demonstrierte und die Volkskammer als „Bereitschaft zur Gewalt“ interpretierte, ließen sich die Demonstranten nicht einschüchtern. Viele junge Menschen hielten Woche für Woche „ihren Rücken“ hin, wurden verhaftet und gaben nicht auf. Die Informationen über die steigende Zahl der Demonstranten wurden über Westmedien verbreitet und wirkten „ermutigend“. Das „Licht der Kerzen“ wurde zu einem Symbol des Widerstands.
Bürgerrechtsbewegungen wie das Neue Forum und Demokratie Jetzt! entstanden, und in Schwante wurde eine SDP (Sozialdemokratische Partei) gegründet. Im September 1989 einigten sich die beiden deutschen Staaten auf die Ausreise der Flüchtlinge aus den Botschaften in Prag und Warschau. Als die Züge durch die DDR fuhren, versuchten Tausende an den Bahnhöfen aufzuspringen, und in Dresden kam es zu Straßenschlachten.
Am 9. Oktober 1989 fand in Leipzig die größte Demonstration in der Geschichte der DDR statt. Trotz der Angst vor Gewalt, die so groß war, dass manche „eine Beruhigungstablette“ nahmen, zeigten die Menschen „großen Mut“. Es gab keine Befehle, die Truppen des Warschauer Paktes einzusetzen, da dieser „nicht mehr als Mechanismus existierte“. Die Rufe „Wir sind das Volk!“ hallten durch die Straßen.
Die Ereignisse überschlugen sich. Erich Honecker wurde aus gesundheitlichen Gründen von seinen Funktionen entbunden. Am 4. November 1989 konfrontierten Hunderttausende bei der größten Demonstration in der Geschichte der DDR auf dem Berliner Alexanderplatz die „diejenigen oben“. Die Menschen waren sich ihrer eigenen Stärke bewusst: „Wir finden zu uns selbst. Wir werden aus Objekten zu Subjekten des politischen Handelns“.
Die entscheidende Wende kam am 9. November 1989. Das Politbüro entschloss sich, eine Reiseregelung zu treffen, die es „jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen“. Als ein Journalist fragte, ob dies auch für West-Berlin gelte, zögerte Günter Schabowski einen Augenblick, sagte dann aber: „Also Ohren angelegt und durch“. Dieser Moment öffnete die Grenzen und löste eine unvergleichliche Welle der Freude und des Zusammenkommens aus.
Das Erbe: Ein „schizophrener Staat der blanken Gegensätze“
Die Revolution, oft als „Revolution der 20-Jährigen“ bezeichnet, führte zur Wiedervereinigung, bei der das westdeutsche System teilweise unhinterfragt übernommen wurde. Für viele blieb die DDR „mein Vaterland“, ein „schizophrener Staat der blanken Gegensätze“. Doch auch in diesem „Gebilde“ war „menschliches Miteinander möglich“. Die DDR war eine „Reibefläche“ für die Identität vieler und bleibt „meine Geschichte“.
Die DDR war der Versuch der Alliierten, Deutschland durch Teilung zu bändigen, und ein stalinistischer Versuch, die sozialistische Idee in die Realität umzusetzen. Sie zerbrach jedoch an ihrer eigenen „Lüge über sich selbst“ (aus vorheriger Konversation) und der Unfähigkeit, den Ruf nach Freiheit und Demokratie zu ignorieren.