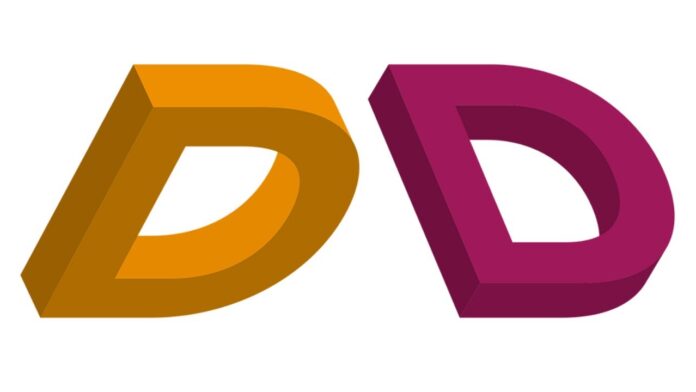35 Jahre nach der Wiedervereinigung ist der Begriff „Deutsche Einheit“ für die junge Generation (15 bis 35 Jahre) kein Grund zum Jubilieren, sondern Anlass für eine tiefgreifende und kritische Debatte. Beim Jugendkongress „Einheit: Jetzt!“ in Berlin, veranstaltet von der Bundesstiftung Aufarbeitung und der Deutschen Gesellschaft e.V., forderten junge Teilnehmende, die Einheit nicht als abgeschlossenen Zustand zu betrachten, sondern als andauernden, mühsamen Prozess.
Die Ergebnisse der intensiven Gespräche und Workshops – in vielfältiger Form als Manifeste, Videos oder Texte übermittelt – machten deutlich, dass die Einheit ein „politisches Wunder“ sei, das die deutsche und europäische Teilung beendete, gleichzeitig jedoch von „Brüchen, Konflikten und Enttäuschungen“ gekennzeichnet ist.
Der kritische Blick auf den Begriff „Einheit“
Viele junge Teilnehmer äußerten „Bauchschmerzen“ mit dem Wort „Einheit“, da es als zu homogenisierend empfunden wird und die anhaltenden Ungleichheiten überdecke. Stattdessen wurden alternative Begriffe wie „Post-Einheit“, „Zusammenkommen“ oder „Verständigung“ in die Diskussion eingebracht.
Die Kernerkenntnis des Kongresses: Einheit könne nur dann funktionieren, wenn die Vielfalt an Perspektiven akzeptiert wird. Sie erfordert eine gemeinsame Aushandlung und die gleichwertige Gültigkeit von Perspektiven (Ost und West, Alt und Jung).
Ein Manifest der Teilnehmenden betonte, dass die Einheit sich „nicht ehrlich anfühlt“ und forderte, die Unterschiede anzuerkennen, anstatt sie zu übergehen. Die Einheit sei ein Prozess, der Vielfalt respektieren müsse und nicht bloß eine „Anpassung der einen an die anderen“ bedeuten dürfe.
Strukturelle Ungleichheiten bleiben bestehen
Die Diskussion, an der auch hochrangige politische Vertreterinnen und Journalisten teilnahmen, beleuchtete die anhaltenden strukturellen Differenzen. Für Westdeutsche brachten die Jahre ab 1990 zwar Veränderungen mit sich, diese waren jedoch nicht existenziell. Für Ostdeutsche hingegen änderte sich „praktisch alles“, was eine historische Zensur in alle Lebensbereiche darstellte.
Die Journalistin Marieke Reimann lieferte konkrete Zahlen zu den Disparitäten:
• Westdeutsche Haushalte besitzen im Durchschnitt das doppelte Vermögen ostdeutscher Haushalte.
• 30 % der Ostdeutschen arbeiten im Niedriglohnsektor.
• Ostdeutsche verdienen durchschnittlich 824 Euro weniger brutto und arbeiten gleichzeitig anderthalb Stunden länger pro Woche.
• Nur etwa 12 % der Personen in Spitzenpositionen haben eine Ost-Biografie, obwohl Ostdeutsche 20–25 % der Bevölkerung ausmachen.
Der Jurist Jonathan Schramm ergänzte, dass der Fokus auf Einheit nicht dazu genutzt werden dürfe, die negativen Unterschiede zu ignorieren, etwa bei Vermögensunterschieden oder der Verteilung von Stiftungen und Wohnungsbaugesellschaften.
Franziska Schubert, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im sächsischen Landtag, berichtete, dass ganze Betriebe verloren gingen und Städte wie ihre Heimatregion in der Oberlausitz 30 % ihrer Einwohner verloren. Sie betonte, dass diese Zeit ihrer Generation eine „gewisse Bruchkompetenz“ im Umgang mit tiefgreifenden Veränderungen mitgegeben habe.
Die unsichtbaren Linien und die Rolle der Medien
Während die physischen Spuren der innerdeutschen Grenze heute kaum noch zu sehen sind, existieren die „unsichtbaren Linien in Biografien, Mentalitäten und Wahrnehmungen“ fort. Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, mahnte in einer Grußbotschaft, dass die entscheidende Grenze heute nicht mehr zwischen Ost und West verläuft, sondern zwischen denen, die sich als Teil eines Ganzen sehen, und jenen, „die sich abgehängt fühlen“.
Junge Teilnehmende kritisierten die westlich dominierte Erinnerungskultur und Medienberichterstattung:
1. Erinnerungskultur: Die offizielle Erinnerung basiert auf Artikel 1 des Einigungsvertrags, der besagt, dass die DDR der BRD beitritt. Dies erzeuge das Gefühl des „Dranklatschens“ und lasse die spezifische Geschichte und Identität der Ostdeutschen unbeachtet. Es fehle die Anerkennung von Errungenschaften der DDR wie der besseren Kindertagesstätten-Infrastruktur oder bestimmten Gleichstellungsthemen.
2. Medien-Framing: Die Berichterstattung sei oft stark pauschalisierend, fokussiere auf Krisen oder Wahlen und argumentiere aus einer westlichen Norm. Stereotypisierung und negatives Framing, wie im Fall eines Dorfes in Sachsen, das in Medien als „rechts“ dargestellt wurde, führen dazu, dass sich Ostdeutsche von überregionalen Medien abwenden, da sie sich dort „verhöhnt oder verlacht“ fühlen.
Die Journalistin Reimann forderte, dass mehr Menschen mit ostdeutscher Biografie in Führungspositionen von Medien vertreten sein müssen, um die Berichterstattung aufzubrechen.
Identitätssuche und politische Verantwortung
Die Suche nach Identität sei besonders in ostdeutschen ländlichen Räumen ein zentrales und problematisches Thema, welches sich im „harten rechten Kurs“ vieler junger Männer manifestiere.
Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Josephine Ortleb (SPD), räumte ein, dass die Perspektiven junger Menschen in den Reden von Politikern zu Feiertagen praktisch gar nicht vorkommen. Sie betonte, sie nehme die Impulse aus der Diskussion mit in den Bundestag, wo Menschen aus ostdeutschen Ländern in politischen Fraktionen, wie der ihren, stark unterrepräsentiert seien.
Angesichts des Erstarkens trennender und exklusiver Kräfte (wie AfD und BSW) forderten die Teilnehmenden, dass die demokratischen Kräfte den Dialog suchen und die Vielfalt der Erfahrungen ernst nehmen. Es brauche Formate wie die Runden Tische und Bürgerrechtsbewegungen, die in der Wendezeit funktionierten, um die Verankerung in der Gesellschaft zu stärken.
Junge Ostdeutsche, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, leisteten „demokratische Arbeit“, was oft nicht entsprechend gewürdigt werde.
Der Jugendkongress dient als Anstoß, die Zukunft der Einheit jetzt zu gestalten. Ein Teilnehmender fasste die Aufgabe zusammen: Die Frage sei nicht nur „was war, sondern auch wo geht es hin“.





 Offizielle Berichte erzählen oft eine klare, aufgeräumte Geschichte, doch die wahre Spannung verbirgt sich häufig zwischen den Zeilen. Der kürzlich veröffentlichte 10. Büromarktbericht von Jena Wirtschaft ist hier keine Ausnahme. Dieser Beitrag wirft einen genaueren Blick auf die Zahlen und beleuchtet die ungelösten Spannungen und tieferen Fragen, die für die Zukunft des Standorts entscheidend sein könnten.
Offizielle Berichte erzählen oft eine klare, aufgeräumte Geschichte, doch die wahre Spannung verbirgt sich häufig zwischen den Zeilen. Der kürzlich veröffentlichte 10. Büromarktbericht von Jena Wirtschaft ist hier keine Ausnahme. Dieser Beitrag wirft einen genaueren Blick auf die Zahlen und beleuchtet die ungelösten Spannungen und tieferen Fragen, die für die Zukunft des Standorts entscheidend sein könnten.


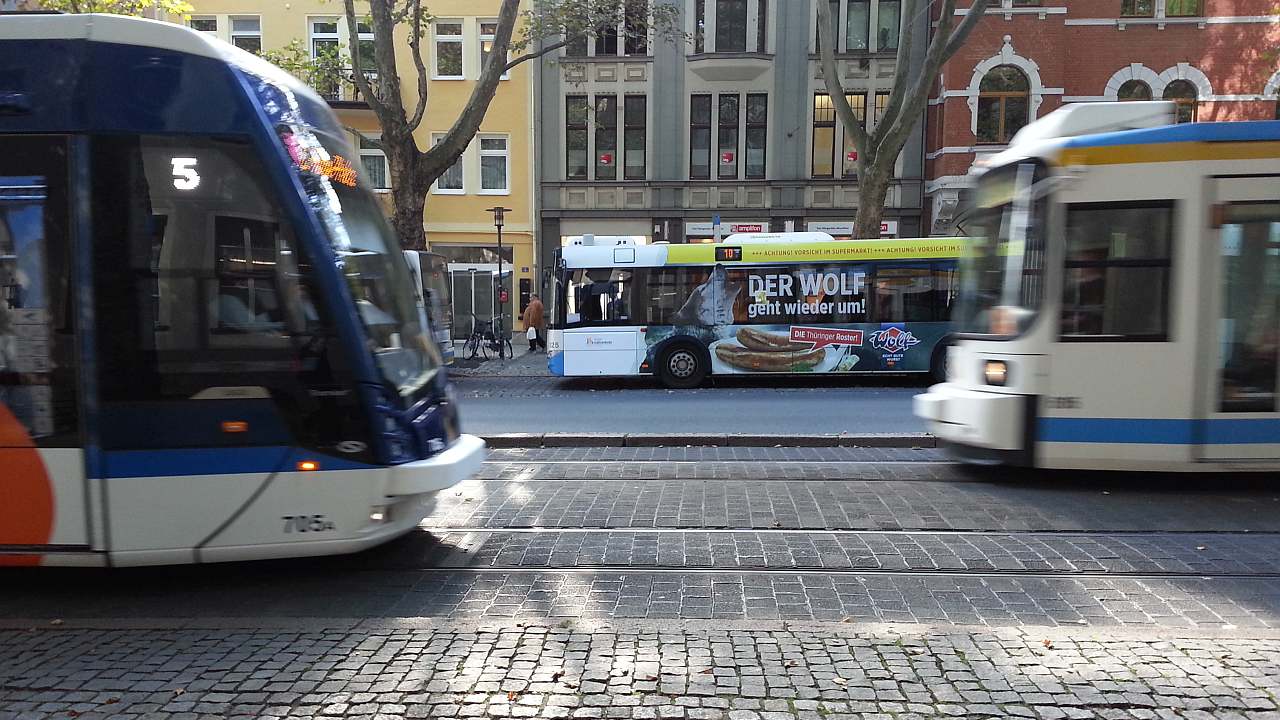


 35 Jahre nach der Wiedervereinigung wird die deutsche Einheit gern als Erfolgsgeschichte erzählt: Mehr Menschen leben heute in Deutschland, mehr Wohlstand, mehr Modernität, mehr Globalität. So klingen die Berichte, so tönen die Reden. Doch ein Blick auf die nackten Zahlen offenbart einen zentralen Widerspruch.
35 Jahre nach der Wiedervereinigung wird die deutsche Einheit gern als Erfolgsgeschichte erzählt: Mehr Menschen leben heute in Deutschland, mehr Wohlstand, mehr Modernität, mehr Globalität. So klingen die Berichte, so tönen die Reden. Doch ein Blick auf die nackten Zahlen offenbart einen zentralen Widerspruch.