 Es roch nach Braunkohle und feuchtem Putz in den Straßen der DDR, doch hinter diskreten Türen und glänzenden Schaufenstern duftete es nach französischem Parfüm und frisch geröstetem Westkaffee. Während die offizielle Propaganda das Hohelied der klassenlosen Gesellschaft sang, etablierte die SED-Führung im Verborgenen ein perfides System der Ungleichheit, das die Bevölkerung in „Wir“ und „Die da oben“ spaltete.
Es roch nach Braunkohle und feuchtem Putz in den Straßen der DDR, doch hinter diskreten Türen und glänzenden Schaufenstern duftete es nach französischem Parfüm und frisch geröstetem Westkaffee. Während die offizielle Propaganda das Hohelied der klassenlosen Gesellschaft sang, etablierte die SED-Führung im Verborgenen ein perfides System der Ungleichheit, das die Bevölkerung in „Wir“ und „Die da oben“ spaltete.
Die Versorgungslage in den 1980er Jahren war prekär. Vor den Kaufhallen bildeten sich Schlangen für Bananen oder Ersatzteile. Doch parallel dazu existierte eine Schattenwirtschaft, die den Mangel für eine auserwählte Kaste außer Kraft setzte. Das sichtbarste Zeichen dieser Doppelmoral waren die „Exquisit“- und „Delikat“-Läden. Ursprünglich als Schaufenster des sozialistischen Wohlstands gedacht, wurden sie schnell zu Symbolen der Ausgrenzung. Hier gab es das, was der „Konsum“ nicht bot: italienische Schuhe, Schweizer Schokolade, Lachs und Ananas. Der Preis dafür war astronomisch, oft nur für jene erschwinglich, die über Westgeld verfügten oder Gehälter bezogen, von denen der Arbeiter nur träumen konnte.
Noch exklusiver und perfider war das System der „Sonderversorgung“. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit, in unscheinbaren Depots und versteckten Verkaufsstellen, bediente sich die Nomenklatura. Wer das richtige Parteibuch besaß, wer im Ministerium für Staatssicherheit oder im Zentralkomitee saß, für den galten die Gesetze der Planwirtschaft nicht. Eine spezielle Berechtigungskarte öffnete den Zugang zu einer Welt, in der Cavia, französischer Cognak und westliche Unterhaltungselektronik stapelweise lagerten. Organisiert wurde dieser staatliche Schmuggel maßgeblich durch die „Kommerzielle Koordinierung“ (KoKo) unter Alexander Schalck-Golodkowski, der Devisen beschaffte, um den Lebensstil der Elite zu finanzieren und den Staatsbankrott hinauszuzögern.
Die Intershops, jene glitzernden Inseln des Westens, in denen die D-Mark regierte, demütigten den DDR-Bürger täglich aufs Neue. Sie führten ihm vor Augen, dass seine eigene Währung und Arbeitskraft zweitrangig waren. Wer „Westverwandtschaft“ hatte, durfte teilhaben; wer nicht, drückte sich die Nase an den Scheiben platt.
Dieses System zementierte nicht nur materielle Unterschiede, es korrumpierte die Moral. Loyalität wurde gekauft – nicht mit Ideologie, sondern mit Bückware. Als die Mauer 1989 fiel, kollabierte auch dieses Kartell des Schweigens. Was blieb, war die bittere Erkenntnis vieler Bürger, dass die gepredigte Gleichheit nie mehr war als eine Fassade, hinter der sich eine privilegierte Oberschicht den Sozialismus bequem eingerichtet hatte.

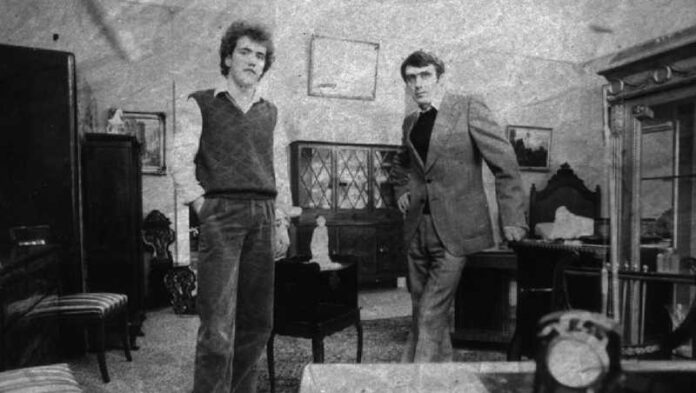
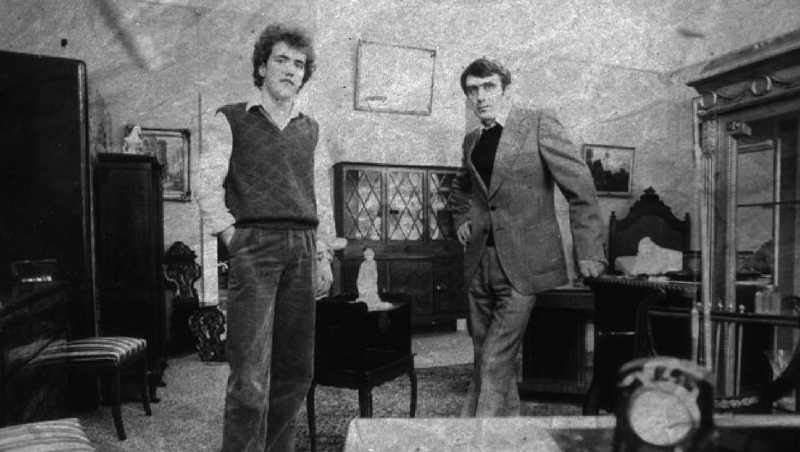 Als die DDR gegründet wurde, stand ein großes Versprechen im Raum: Ein Land ohne Klassen, ohne Ausbeutung, in dem der Reichtum gerecht verteilt ist. Doch wer hinter die Fassade der sozialistischen Parolen blickte, erkannte schnell, dass auch im Arbeiter- und Bauernstaat manche gleicher waren als andere. Die offizielle Doktrin der Gleichheit wurde im Alltag durch ein feingesponnenes Netz aus Beziehungen, Privilegien und einer inoffiziellen Währung ausgehöhlt.
Als die DDR gegründet wurde, stand ein großes Versprechen im Raum: Ein Land ohne Klassen, ohne Ausbeutung, in dem der Reichtum gerecht verteilt ist. Doch wer hinter die Fassade der sozialistischen Parolen blickte, erkannte schnell, dass auch im Arbeiter- und Bauernstaat manche gleicher waren als andere. Die offizielle Doktrin der Gleichheit wurde im Alltag durch ein feingesponnenes Netz aus Beziehungen, Privilegien und einer inoffiziellen Währung ausgehöhlt.
 Beton kann sprechen. Zumindest, wenn es nach Hermann Henselmann ging, sprach er die Sprache der Macht, der Ordnung und einer neuen gesellschaftlichen Utopie. Wer heute die Karl-Marx-Allee in Berlin entlangschreitet, wandert nicht nur durch eine Straße, sondern durch das versteinerte Ideal eines Mannes, der die visuelle Identität der DDR prägte wie kein Zweiter. Henselmann, 1905 als Handwerkersohn geboren, war weit mehr als ein bloßer Bauleiter; er war der Szenenbildner einer Republik, die sich über ihre Fassaden definierte.
Beton kann sprechen. Zumindest, wenn es nach Hermann Henselmann ging, sprach er die Sprache der Macht, der Ordnung und einer neuen gesellschaftlichen Utopie. Wer heute die Karl-Marx-Allee in Berlin entlangschreitet, wandert nicht nur durch eine Straße, sondern durch das versteinerte Ideal eines Mannes, der die visuelle Identität der DDR prägte wie kein Zweiter. Henselmann, 1905 als Handwerkersohn geboren, war weit mehr als ein bloßer Bauleiter; er war der Szenenbildner einer Republik, die sich über ihre Fassaden definierte.
 Berlin, Hauptstadt der DDR. In den kühlen Morgenstunden roch die Stadt nach Braunkohle, Zweitaktgemisch und nassem Asphalt. Die Bürger warteten geduldig vor den HO-Läden, die Einkaufsnetze bereit für das, was der Tag bringen mochte – oder auch nicht. Doch nur wenige Straßen weiter, verborgen hinter unscheinbaren Fassaden und schweren Samtvorhängen, existierte eine völlig andere Realität. Eine Welt, in der der Sozialismus nach französischem Parfum, Havanna-Zigarren und äthiopischem Kaffee duftete.
Berlin, Hauptstadt der DDR. In den kühlen Morgenstunden roch die Stadt nach Braunkohle, Zweitaktgemisch und nassem Asphalt. Die Bürger warteten geduldig vor den HO-Läden, die Einkaufsnetze bereit für das, was der Tag bringen mochte – oder auch nicht. Doch nur wenige Straßen weiter, verborgen hinter unscheinbaren Fassaden und schweren Samtvorhängen, existierte eine völlig andere Realität. Eine Welt, in der der Sozialismus nach französischem Parfum, Havanna-Zigarren und äthiopischem Kaffee duftete.
 In der offiziellen Lesart der Deutschen Demokratischen Republik war Reichtum ein Relikt des verhassten Kapitalismus. Die Losungen an den Fabrikmauern priesen Gleichheit, Brüderlichkeit und Solidarität. Doch hinter den grauen Fassaden der Plattenbauten und den hohen Mauern der Funktionärssiedlungen etablierte sich eine Realität, die den sozialistischen Traum ad absurdum führte: Eine Klassengesellschaft, in der nicht das Bankkonto, sondern Beziehungen, Parteibücher und der Zugang zu „Westgeld“ über den sozialen Status entschieden.
In der offiziellen Lesart der Deutschen Demokratischen Republik war Reichtum ein Relikt des verhassten Kapitalismus. Die Losungen an den Fabrikmauern priesen Gleichheit, Brüderlichkeit und Solidarität. Doch hinter den grauen Fassaden der Plattenbauten und den hohen Mauern der Funktionärssiedlungen etablierte sich eine Realität, die den sozialistischen Traum ad absurdum führte: Eine Klassengesellschaft, in der nicht das Bankkonto, sondern Beziehungen, Parteibücher und der Zugang zu „Westgeld“ über den sozialen Status entschieden.
 Erfurt/Weimar – Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt hat auf der heutigen Regierungsmedienkonferenz weitreichende Ergebnisse der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) und des Thüringer Kabinetts vorgestellt. Im Zentrum standen dabei zwei wesentliche Erfolge für den Freistaat: eine umfassende Entbürokratisierungsoffensive und die Stärkung Weimars als Medienstandort.
Erfurt/Weimar – Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt hat auf der heutigen Regierungsmedienkonferenz weitreichende Ergebnisse der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) und des Thüringer Kabinetts vorgestellt. Im Zentrum standen dabei zwei wesentliche Erfolge für den Freistaat: eine umfassende Entbürokratisierungsoffensive und die Stärkung Weimars als Medienstandort.
 Der DEFA-Dokumentarfilm „DDR-Magazin 1978/12“ zeichnet ein Porträt des Bezirks Rostock, das heute wie eine Flaschenpost aus einer vergangenen Ära wirkt. Er zeigt eine Region im Spagat zwischen sozialistischer Industriemacht und der sommerlichen Leichtigkeit des Urlauberparadieses.
Der DEFA-Dokumentarfilm „DDR-Magazin 1978/12“ zeichnet ein Porträt des Bezirks Rostock, das heute wie eine Flaschenpost aus einer vergangenen Ära wirkt. Er zeigt eine Region im Spagat zwischen sozialistischer Industriemacht und der sommerlichen Leichtigkeit des Urlauberparadieses.
 MAGDEBURG. Es ist ein sonniger Wintermorgen in Magdeburg, als Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und sein Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) vor die Landespresse treten. Doch die Zahlen, die sie im Gepäck haben, zeichnen das Bild eines Bundeslandes, über dem dunkle Wolken hängen – zumindest in den Köpfen der Menschen. Der „Sachsen-Anhalt-Monitor 2025“ liegt vor, und er offenbart einen tiefen Riss, der sich durch die Gemütslage zwischen Arendsee und Zeitz zieht.
MAGDEBURG. Es ist ein sonniger Wintermorgen in Magdeburg, als Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und sein Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) vor die Landespresse treten. Doch die Zahlen, die sie im Gepäck haben, zeichnen das Bild eines Bundeslandes, über dem dunkle Wolken hängen – zumindest in den Köpfen der Menschen. Der „Sachsen-Anhalt-Monitor 2025“ liegt vor, und er offenbart einen tiefen Riss, der sich durch die Gemütslage zwischen Arendsee und Zeitz zieht.
 Torgau. »Wenn mir vor 35 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich heute in aller Öffentlichkeit über den geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau reden würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt.« Alexander Müller sitzt heute als freier Mann da, doch die Schatten seiner Jugend in der DDR reichen weit. Er ist ein Zeitzeuge jener brutalen Maschinerie, die Margot Honecker einst als notwendig für „Kriminelle“ bezeichnete, die in Wahrheit aber oft nur eines waren: unangepasst.
Torgau. »Wenn mir vor 35 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich heute in aller Öffentlichkeit über den geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau reden würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt.« Alexander Müller sitzt heute als freier Mann da, doch die Schatten seiner Jugend in der DDR reichen weit. Er ist ein Zeitzeuge jener brutalen Maschinerie, die Margot Honecker einst als notwendig für „Kriminelle“ bezeichnete, die in Wahrheit aber oft nur eines waren: unangepasst.
 Rostock, 1971. Ein kühler Wind weht durch die Kasernentore, als für junge Männer aus der DDR ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Es sind 18 Monate, die ihre Jugend unterbrechen, 18 Monate „Dienst an der Waffe“. Der DEFA-Dokumentarfilm „Einberufen“ von Regisseur Winfried Junge ist ein bemerkenswertes Zeitdokument, das sich wohltuend von der üblichen militärischen Propaganda jener Jahre abhebt. Statt stählerner Helden zeigt Junge Menschen. Statt ideologischer Phrasen fängt er leise Zweifel und den pragmatischen Unmut der Rekruten ein.
Rostock, 1971. Ein kühler Wind weht durch die Kasernentore, als für junge Männer aus der DDR ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Es sind 18 Monate, die ihre Jugend unterbrechen, 18 Monate „Dienst an der Waffe“. Der DEFA-Dokumentarfilm „Einberufen“ von Regisseur Winfried Junge ist ein bemerkenswertes Zeitdokument, das sich wohltuend von der üblichen militärischen Propaganda jener Jahre abhebt. Statt stählerner Helden zeigt Junge Menschen. Statt ideologischer Phrasen fängt er leise Zweifel und den pragmatischen Unmut der Rekruten ein.