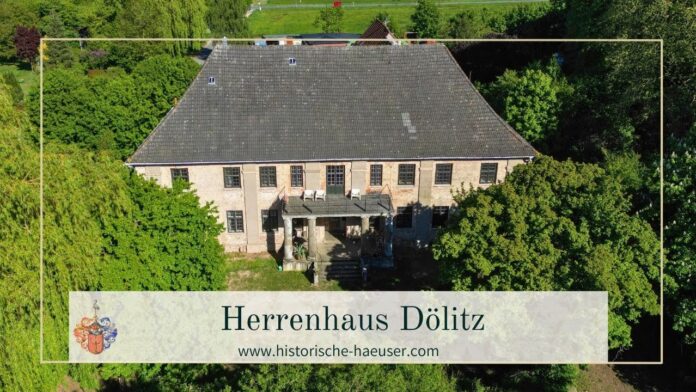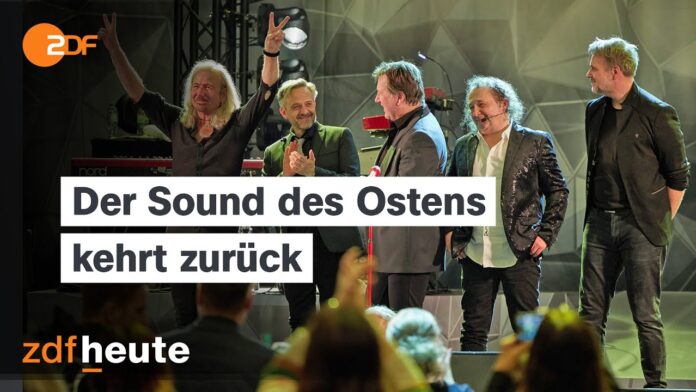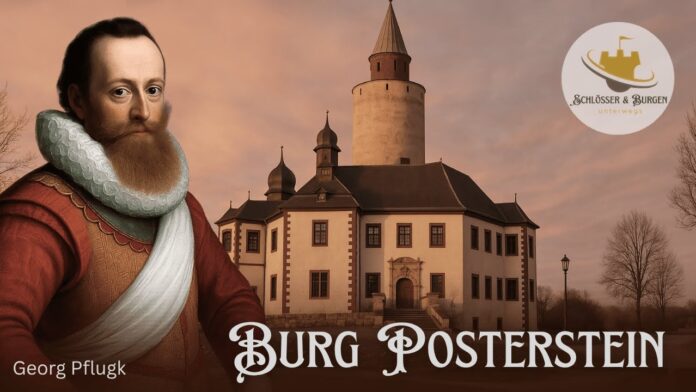In Altchemnitz, an der Elsaser Straße, steht ein Gebäude, das einst den Stolz der Chemnitzer Textilindustrie repräsentierte. Errichtet etwa 1926/27 als kombinierter Schul- und Bürobau, diente es der Höheren Fachschule für Wirkerei und Stickereiindustrie Chemnitz und Limbach, da das bestehende Schulgebäude an der Sedanstraße (heute Wilhelm-Raabe-Straße) nicht mehr ausreichte. Der Name „Wirksschule“ leitet sich analog zum „Wirkbau“ (Textilmaschinenbau in der Nähe) vom Begriff „Fadenschlingen“ aus der Textiltechnologie ab.
Obwohl das Gebäude an der Elsaser Straße durch den Zweiten Weltkrieg erheblich beschädigt wurde und eigentlich abgerissen werden sollte, entschied man sich aufgrund der großen Bedeutung der Textilindustrie für den Weiterbetrieb als Ausbildungszentrum. Bereits 1950 wurde hier die Ingenieurschule für Textiltechnologie Chemnitz, später Karl-Marx-Stadt, eingerichtet. Diese bot ein breites Ausbildungsspektrum und war während der Teilung Deutschlands die größte Fachschule für Textil- und Bekleidungsindustrie in der DDR. Bis zu 700 Meister, Techniker und Ingenieure im Textilbereich konnten hier gleichzeitig ausgebildet werden. Die Wirksschule leistete so einen Beitrag zum Erfolg und Transfer der Chemnitzer Technologien in der Textilindustrie.
Im Jahr 1969 wurde die Ausbildung im Textilbereich an die Technische Hochschule (TH), die heutige Technische Universität (TU) Chemnitz, angegliedert. Damit gingen auch die Gebäude an der Sedanstraße und der Elsaser Straße in den Besitz der Hochschule über. Ende der 1980er Jahre befanden sich jedoch beide Schulgebäude in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Während das Gebäude an der Wilhelm-Raabe-Straße (ehemals Sedanstraße) Anfang der 1990er Jahre umfangreich saniert und rekonstruiert wurde und ab November 1994 Sitz der Philosophischen Fakultät und später des Instituts für Psychologie wurde, verschlechterte sich der Zustand an der Elsaser Straße.
In den 1990er Jahren nutzten die neugegründeten Fakultäten Wirtschaftswissenschaften und Philosophie zwar noch die Hörsäle der Wirksschule. Der Standort an der Elsaser Straße wird in der Chronik der TU Chemnitz noch einmal am 22. März 1995 erwähnt, als dort ein Versuchsfeld für Stückgutfördertechnik öffnete. Doch die vorhandenen Hörsäle entsprachen nicht mehr dem Zeitgeist, und 1998 wurde ein neues Hörsaalgebäude auf dem Campus an der Reichenhainer Straße eröffnet. Wann genau der universitäre Teil an der Elsaser Straße aufgegeben wurde, lässt sich nicht mehr exakt ermitteln, vermutet wird aber die Zeit etwa um 1997/98 mit der Eröffnung des neuen Hörsaalgebäudes.
Die Gründe, warum die TU Chemnitz den Standort an der Elsaser Straße aufgab, dürften vielschichtig sein. Die schlechte Bausubstanz Ende der 80er Jahre, die nicht mehr zeitgemäßen Hörsäle und die Abseitigkeit des Standortes im Vergleich zum zentraleren Campus Reichenhainer Straße spielten wohl eine Rolle.
Nach der Schließung als Universitätsstandort verfiel die Wirksschule zusehends. Bereits aus den 2000er Jahren gibt es Aufnahmen, die zeigen, wie Bäume auf dem Bürogebäude wuchsen. Um 2010 diente die Wirksschule zudem als inoffizielle Unterkunft für Obdachlose. Der Bauzustand verschlechterte sich weiter. Teile des Dachbodens des Bürogebäudes waren bereits in den 2000er Jahren eingestürzt. Eine Katastrophe ereignete sich am 10. oder 11. August 2013, als ein Dachstuhlbrand das komplette Dach des Gebäudes vernichtete.
Obwohl sich der Gebäudeverbund der ehemaligen Wirksschule unter Denkmalschutz befindet, bleibt der Grund, warum die TU Chemnitz diesen über Jahre vernachlässigte und schließlich ganz verließ, Gegenstand von Vermutungen. Während die TU Chemnitz zuletzt mit ihrer Universitätsbibliothek in die aufwendig sanierte und umgebaute Alte Aktienspinnerei gezogen ist, scheint der Standort an der Elsaser Straße, die alte Wirksschule, vergessen zu sein.
Es bleibt die Frage nach potenziellen zukünftigen Nutzungen und ob der Denkmalschutz noch zum Erhalt des Objektes beitragen kann. Fest steht nur, dass die alte Wirksschule eine wichtige Rolle in der Geschichte der Chemnitzer Textilindustrie und Ausbildung gespielt hat.