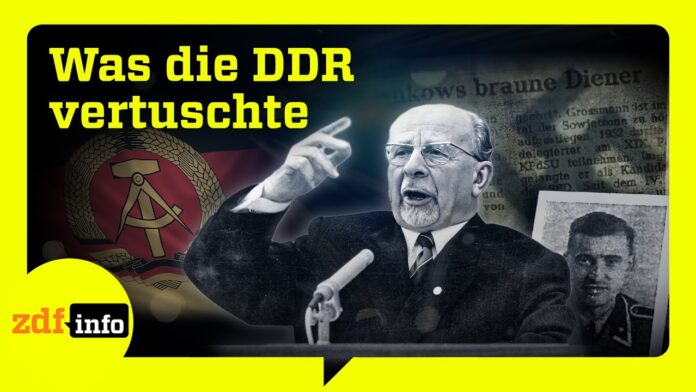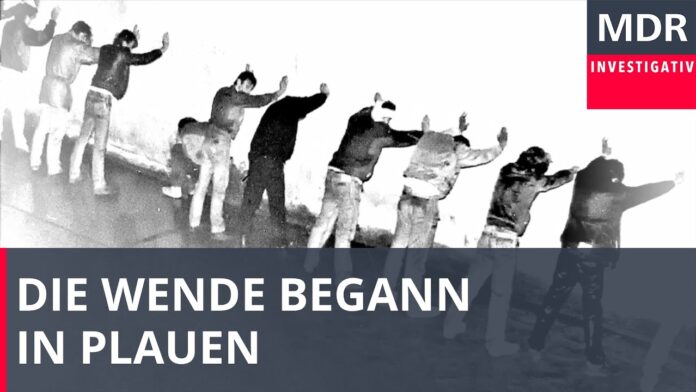Die Deutsche Demokratische Republik – eine geheimnisvolle Diktatur. Offiziell präsentierte sie sich als das „bessere Deutschland“, ein blühendes Land dank des Sozialismus, das eine bessere Zukunft versprach. Doch die Wirklichkeit des Sozialismus und der Alltag der Menschen klafften oft weit auseinander. Vieles wurde geheim gehalten und kam erst Jahre nach dem Fall der Mauer ans Licht.
Die DDR-Führung setzte auf die Kraft der Propaganda, um ihre Bürger zu motivieren. Eine prominente Figur dieser Bemühungen war Frieda Hockauf, eine Weberin aus Zittau, die 1953 zur „Ikone der DDR“ wurde. Sie wurde als Heldin der Arbeit geehrt, nachdem es ihr gelang, deutlich mehr Stoff zu weben als ihre Arbeitsnorm es verlangte. Hockauf wurde zum Vorbild einer Aktivistenbewegung, die seit 1948 existierte und die Menschen zu höherer Produktivität anspornen sollte. Besonders Frauen sollten dadurch mobilisiert werden, da sie die einzige Arbeitskräftereserve darstellten, auf die die DDR zurückgreifen konnte – im Gegensatz zur Bundesrepublik, die Ende der 1950er Jahre Gastarbeiter aufnahm. Die Propaganda zeigte, wie Frauen in der ganzen DDR Frieda Hockauf nacheiferten.
Die wahre Geschichte Hockaufs wurde der Bevölkerung jedoch verschwiegen. Ihre Rekorde brachten ihr bei Kolleginnen Beschimpfungen als „Normenbrecherin“ und „Verräterin“ ein. Eier und Steine flogen, ihr Mann musste sie von der Arbeit abholen, und ihr Webstuhl wurde sabotiert. Solche „Normenbrecher“ stießen in der Arbeitswelt auf Widerstand, da sie suggerierten, dass doppelte Leistung möglich sei. Frieda Hockauf wechselte schließlich den Job und wurde, nachdem sie schwer herzkrank wurde, von der Partei fallen gelassen. Eine Nachbarin beschrieb ihr Schicksal treffend: arm geboren, arm gestorben.
Trotz der Propaganda lief die Wirtschaft der DDR der Bundesrepublik deutlich hinterher. Anfang der 1960er Jahre war von Reformen die Rede, da den Verantwortlichen klar war, dass die Wirtschaft nicht optimal funktionierte. Engpässe, insbesondere bei Lebensmitteln, waren ein ernstes Problem. Der Versuch, alle Kleinbauernhöfe in Genossenschaften (LPGs) zu überführen, führte zunächst zu Missernten und zur Flucht von Bauern in den Westen. Die Investitionen konzentrierten sich auf Schwerindustrie wie Chemie, Elektro und Maschinenbau, doch auch dort fehlten Mittel und Arbeitskräfte. Dieser Teufelskreislauf mündete in die Krise von 1961. Die Reaktion der Führung war radikal: die Schließung der Grenze durch den Mauerbau. Der eigentliche Hintergrund war, die Volkswirtschaft dadurch planbar zu machen. Die Bürger, die blieben, mussten die Folgen tragen: mehr arbeiten und weniger dafür erhalten. Dies nährte die Wut und führte zu Hunderten wilder Streiks, die die DDR Anfang der 1960er Jahre erschütterten, insbesondere in Industriezentren wie Leuna. Diese Streiks fanden kaum Erwähnung in der DDR-Presse, während im Westen Gerüchte kursierten und teils auch Falschmeldungen verbreitet wurden. Die Unruhe in Bevölkerung und Betrieben setzte die Führung unter Druck und bestärkte sie in der Notwendigkeit von Wirtschaftsreformen. Diese wurden jedoch aus Angst vor Kontrollverlust der Partei wieder gestoppt.
Um die fehlenden Arbeitskräfte zu kompensieren, wurden Frauen noch stärker in die Berufstätigkeit gedrängt. Der Staat versprach, sich um die Kinderbetreuung zu kümmern. Ein zentrales Element waren die Wochenkrippen, in denen Kinder ab der sechsten Lebenswoche montags abgegeben wurden und ihre Eltern nur am Wochenende sahen. Offiziell als Entlastung für die Eltern beworben, glichen diese Einrichtungen in Wirklichkeit eher Kinderheimen.
Die Ärztin Eva Schmidtkolmer untersuchte Anfang der 1950er Jahre die Entwicklung von Krippenkindern. Ihre dramatischen Ergebnisse, die nur in Fachkreisen bekannt wurden, zeigten, dass Wochenkrippenkinder in allen Bereichen hinter Gleichaltrigen zurückblieben. Sie dokumentierte Hospitalismus, ausdruckslose, sich schaukelnde Kleinkinder. Den Eltern wurden diese Befunde vorenthalten. Obwohl viele Kinderärzte warnten und Schmidtkolmer versuchte, Veränderungen anzustoßen, wurde sie zunehmend „mundtot gemacht“. Das gravierendste Problem war, dass die Probleme der Kinder bekannt waren, aber nicht öffentlich diskutiert wurden. Bis zum Ende der DDR wurden Vergleichsstudien behindert. Dieses Vorgehen beschädigte den Mythos, dass die Produktionssteigerung nicht zu Lasten der Menschen ginge. Heike Liebsch, die selbst als Kind in einer Wochenkrippe war, interviewte später ehemalige Wochenkrippenkinder für ihre Doktorarbeit. Viele berichteten von gestörten Elternbeziehungen, Partnerschaftsproblemen und Ängsten. Liebschs Forschung half ihr und anderen, eigene Ängste besser zu verstehen.
Eine zentrale Säule des DDR-Selbstverständnisses war die Freundschaft mit der Sowjetunion, der Schutzmacht und dem „großen Bruder“. Diese „Waffenbrüderschaft“ wurde propagandistisch gefeiert. Die Realität sah anders aus: Es gab kein Verhältnis auf Augenhöhe. Die sowjetischen Truppen schotteten sich hermetisch ab. Was hinter den Sperrzäunen geschah, war Staatsgeheimnis. Gerüchte über Atomwaffenlager kursierten. Historiker konnten später bestätigen, dass in Großräschen seit 1963 sowjetische Nuklearwaffen gelagert wurden, was der DDR-Führung jedoch unbekannt war. Die Lebensverhältnisse der sowjetischen Soldaten waren oft ärmlich und von Gewalt geprägt. Desertionen und kriminelle Handlungen waren verbreitet. Viele Soldaten riskierten ihr Leben bei Fluchtversuchen.
Persönliche Beziehungen zwischen sowjetischen Soldaten und ostdeutschen Frauen waren schwierig und oft unerwünscht. Soldaten, insbesondere Offiziere, galten als Geheimnisträger, und Beziehungen wurden als Gefahr für ihren Status angesehen. Frauen, die solche Beziehungen eingingen, wurde unterstellt, die Rote Armee zersetzen oder spionieren zu wollen. Dies führte zu vielen individuellen Schicksalen, wie dem von Renate Walter, einem sogenannten „Russenkind“. Sie erfuhr erst zufällig als Jugendliche den Namen ihres sowjetischen Vaters Alexander Bessarabow. Ihr Vater kämpfte um die Beziehung zu ihrer Mutter Hildegard und ihr, wurde aber vermutlich wegen des Kindes unehrenhaft entlassen. Viele „Russenkinder“ erfuhren nie, wer ihre Väter waren, da die Mütter schwiegen. Auch Anfeindungen gegen die Kinder waren nicht unüblich.
Ein weiterer Gründungsmythos der DDR war der konsequente Antifaschismus. Der Nationalsozialismus wurde als „Faschismus“ bezeichnet, um ihn vom Sozialismus abzugrenzen. 1950 erklärte die DDR die Entnazifizierung für abgeschlossen. Nazis gab es angeblich nur im Westen. Doch die Realität war komplizierter. Man verfolgte NS- und Kriegsverbrecher, lud aber auch die „breite Mehrheit“ und „Belasteten“ zum Mitmachen ein. Das Angebot lautete: Wer sich für den demokratischen Aufbau einsetzt, dessen Sünden aus der Vergangenheit werden nicht weiter thematisiert. Beispiele wie Ernst Grossmann, ein ehemaliger Angehöriger der SS-Totenkopfverbände und der Wachmannschaft des KZ Sachsenhausen, der später SED-Spitzenkandidat und Vorsitzender der ersten LPG wurde, zeigen, dass Altnazis auch in der DDR Karriere machen konnten und sich nicht vor Gericht verantworten mussten. Die Stasi wusste über Grossmanns Vergangenheit Bescheid.
Trotz des offiziellen Antifaschismus tauchten gerade in den 1980er Jahren Neonazis als sichtbares Problem auf. Kriminalisten und Soziologen der Humboldt-Universität stellten fest, dass diese Jugendlichen zu 80% aus als „solide“ geltenden Elternhäusern stammten – ihre Ergebnisse blieben geheim. Experten sehen einen Zusammenhang mit dem Autoritätsverlust der älteren Generation Ende der 1980er Jahre; alte ideologische Autoritäten spielten keine Rolle mehr, neue gab es nicht. Das Benutzen von Nazi-Symbolen wurde zu einer starken Provokation gegen den antifaschistischen Staat. Gleichzeitig verkörperten diese Strömungen Werte, die durchaus in der DDR-Gesellschaft verbreitet waren: ein Ordnungsdenken, Sicherheitsdenken, eine gewisse Fremdheit gegenüber anderen Kulturen. Sogar Kriegsverbrecher wie Heinz Barth, beteiligt am Massaker von Oradour, wurden in Haft mit jungen Neonazis zusammengebracht und gaben dort ihre Weltbilder weiter. Der Prozess gegen Barth 1983 wurde zwar als Propagandaerfolg gefeiert, doch auch hier gab es ein dunkles Geheimnis: Zwei weitere an dem Massaker Beteiligte wurden nicht angeklagt.
Die DDR-Führung stürzte schließlich auch über ihre geheimen Machenschaften. Als die Menschen 1989 die Mauer zu Fall brachten und 1990 die Stasi-Zentrale stürmten, zeigte sich, wie viele Geheimnisse es in der DDR noch gab. Die Diskrepanz zwischen dem propagierten Ideal und der verborgenen Realität prägte das Leben vieler Menschen.