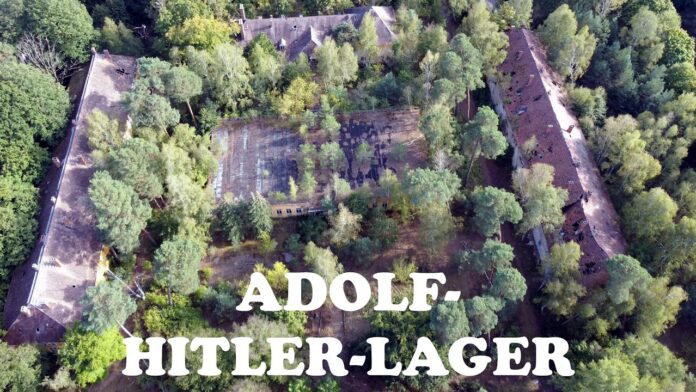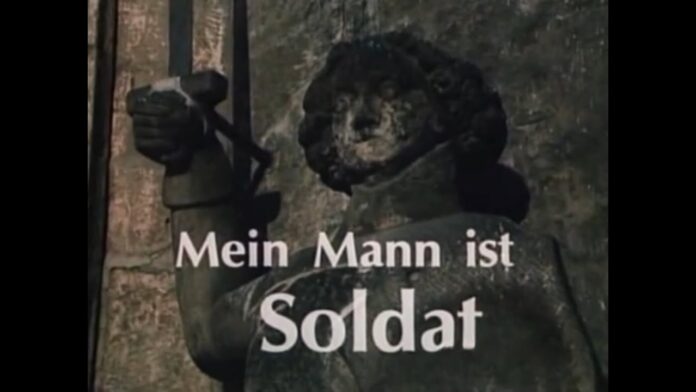Schwedt/Oder, Brandenburg – Die industriell geprägte Stadt Schwedt in Brandenburg befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Strukturwandels, der Zukunftsängste schürt und das politische Klima verändert. Seitdem der Bund beschlossen hat, auf Öl aus Russland zu verzichten, steht die PCK Raffinerie, das wirtschaftliche Herz der Stadt, vor massiven Problemen.
Jahrzehntelang war Schwedt eng mit der PCK Raffinerie verbunden, die kontinuierlich mit russischem Öl versorgt wurde. Doch der Krieg gegen die Ukraine hat diese Ära abrupt beendet. Seit 2023 darf kein russisches Öl mehr über die Druschba-Pipeline importiert werden. Die Raffinerie, mehrheitlich im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft und unter deutscher Treuhandverwaltung, muss ihr Öl nun teuer auf dem Weltmarkt einkaufen – ein unwirtschaftliches Unterfangen.
„PCK hustet, der Rest hat Lungenentzündung“
Die Folgen sind dramatisch. Konstanze Fischer, eine Augenärztin in Schwedt, bringt die Sorge auf den Punkt: „Die Sorge ist einfach, dass wenn dieser industrielle Kern praktisch verloren geht, dann fallen eine Menge gute Arbeitsplätze weg, dann fallen in der Umgebung dieser PCK Raffinerie gute Arbeitsplätze weg und dann werden die jungen Leute wegziehen komplett und dann ist das sowas so, wo man dann irgendwann, ich sage mal, ein Zaun drum machen kann und Wolfsbeobachtungsgebiet“. Dieser Satz fasst die Befürchtungen vieler zusammen, die spüren, dass „wenn PCK hustet, [dann hat] der Rest des Landes hier Lungenentzündung“.
Tatsächlich läuft die Raffinerie teilweise unter 80 Prozent Auslastung, während die Kosten bei 100 Prozent bleiben, was zu Unwirtschaftlichkeit führt. Ein Hauptgrund ist die unzureichende Kapazität der Pipeline vom Rostocker Hafen nach Schwedt; ein Ausbau wird von der Belegschaft dringend gefordert.
Die wirtschaftliche Unsicherheit schlägt sich auch in sinkenden Steuereinnahmen nieder. Die Bürgermeisterin berichtet von einem massiven Gewerbesteuereinbruch, der bereits dazu geführt hat, dass geplante Sanierungen, wie die einer Straße, aus dem städtischen Haushalt gestrichen werden mussten.
Politische Ernüchterung und neue Hoffnung
Die Frustration der Bürger ist spürbar. Bei der vergangenen Bundestagswahl erhielten AfD und BSW in Schwedt mehr als die Hälfte der Stimmen – ein deutlicher Bruch mit der Vergangenheit, denn Schwedt war einst eine absolute SPD-Hochburg. Viele fühlen sich von politischen Versprechen enttäuscht. Der Bundeswirtschaftsminister hatte vor über zwei Jahren eine Umwandlung des Standortes in eine Drehscheibe für Wasserstoff statt Erdöl in Aussicht gestellt, doch „viel passiert ist aber bislang nicht“. Ministerpräsident Dietmar Woidke (Brandenburg) hat sich zwar für Fördermittel zur Ansiedlung von Zukunftstechnologien eingesetzt, doch die konkreten Auswirkungen stehen noch aus.
Trotz der Widrigkeiten regt sich in Schwedt auch Widerstand und der Wille zur Gestaltung der Zukunft. Unternehmen der Stadt und eine regionale Hochschule haben eine Startup Challenge ausgerufen, um Gründerfirmen mit grünen Technologien und Fördermitteln die Veränderung vorantreiben zu lassen. Ein konkretes Projekt ist das geplante Transformationszentrum, kurz Trafo, das auf dem Platz des alten Busbahnhofs entstehen soll und rund 18 Millionen Euro Fördermittel von der EU erhält.
Während Schwedt weiterhin mit nicht genügend Öl für seine Raffinerie zu kämpfen hat, klammert sich die Stadt an die Hoffnung, durch neue Technologien und lokale Initiativen einen Weg aus der Krise zu finden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, um den befürchteten Exodus junger Menschen und den Niedergang einer ganzen Region abzuwenden.