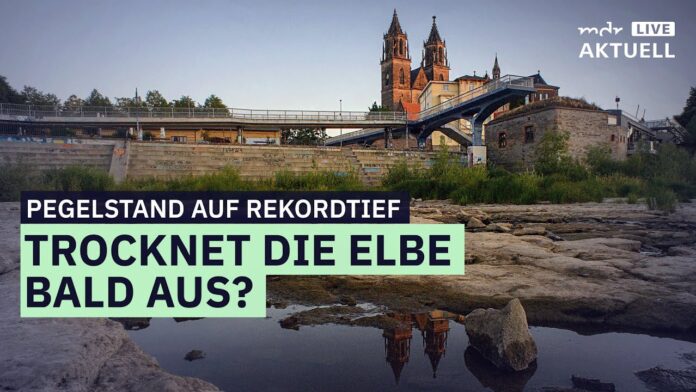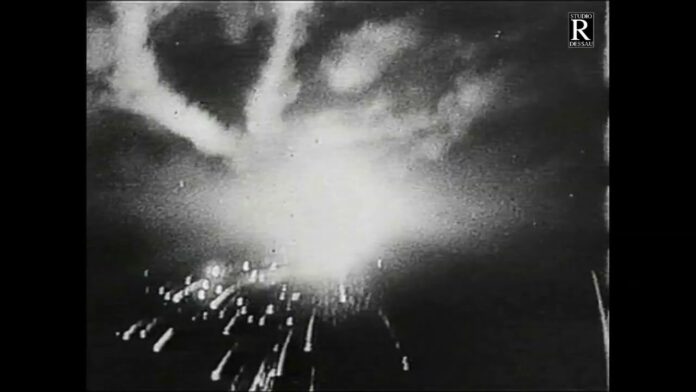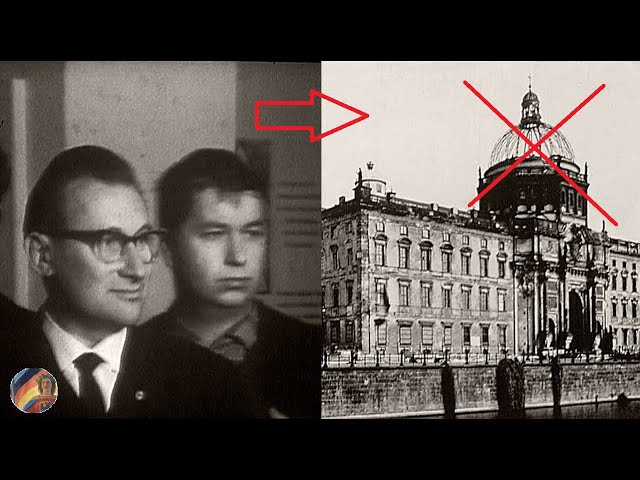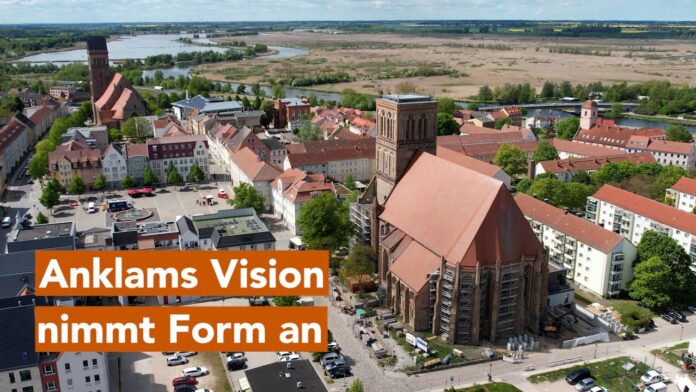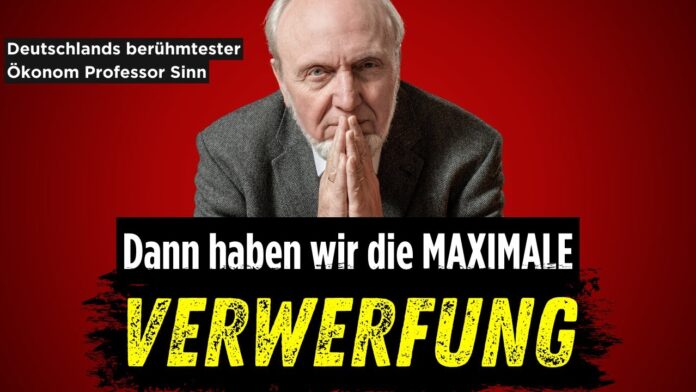Vor über einem Jahrhundert, im Jahr 2019, feierte die berühmte deutsche Kunstschule, das Bauhaus, ihr großes Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen. Die Ideale dieser innovativen, freigeistigen und bisweilen chaotischen Kunstschule sind 100 Jahre später relevanter als sie es damals waren. Das Bauhaus stellte vor einem Jahrhundert grundlegende Fragen nach einer anderen Zukunft: Wie werden wir lernen? Wie werden wir leben?. Obwohl das Bauhaus historisch nur eine kurze Episode war, reichen seine Strahlkraft und Magie bis in unsere Gegenwart und definieren bis heute die moderne Welt. Mit seinen gesellschaftlichen Ideen und Design-Prinzipien kann das Bauhaus auch heute noch Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit geben.
Die Schule, gegründet 1919 im deutschen Weimar und 1925 nach Dessau umgezogen, existierte nur 14 Jahre, bevor sie 1933 unter dem Druck der Nationalsozialisten in Berlin geschlossen wurde. Doch in dieser Zeit wurde alles – Architektur, Malerei, Typografie, Design, Tanz, Pädagogik – am Bauhaus gelehrt, erforscht und gelernt. Es war ein Aufbruch und ein Experiment mit dem Anspruch, Gestaltung von Grund auf neu zu denken. Renommierte Künstler wie Walter Gropius, Hannes Meyer, Mies van der Rohe, Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky, Paul Klee, László Moholy-Nagy, Anni Albers, Josef Albers und Gunta Stölzl folgten dem Ruf Gropius‘. Das Bauhaus hatte den Anspruch, eine universelle Gestaltungsbauweise zu formulieren, die sicherstellen sollte, dass alles seine perfekte Höhe und Größe hatte und optimal für den Menschen nutzbar war. Ihr Ziel war es, die Trennung zwischen Handwerkern, Designern und Künstlern zu überwinden. Mit der Machtergreifung Hitlers und der Schließung der Schule emigrierten die Bauhäusler und verbreiteten so die Ideen und Visionen des Bauhauses in der ganzen Welt.
Der Traum vom besseren Leben: Gropiusstadt und die Realität
Anfang der 1960er-Jahre sollte in Deutschland, 30 Jahre nach dem Ende des Bauhauses, die große Utopie, das Leben der Menschen besser zu machen, Wirklichkeit werden. Walter Gropius, der zu dieser Zeit bereits lange in den USA lebte, plante vor den Toren Berlins eine Großsiedlung, um die Wohnungsnot mit Methoden des modernen Städtebaus zu bekämpfen. Fast alle Wohnungen waren für sozial Schwächere gedacht, und der Einzug in die Gropiusstadt galt als „absoluter Luxus“, da warmes Wasser aus der Wand kam. Ziel war es, neuen Wohnraum im Grünen zu schaffen, da in Berlin bereits vor dem Zweiten Weltkrieg Hinter- und Seitenhäuser in dicht bebauten Vierteln abgerissen worden waren, um mehr Licht, Luft und Sonne zu ermöglichen. Gropius plante seine Siedlung als eine Utopie, eine große Stadtlandschaft. Er wollte keine Reste von Grünflächen, sondern eine Stadtlandschaft, die sich frei zwischen den Gebäuden hindurchbewegte, eine Natur, die nicht gekappt wurde, sondern durch den neuen Stadtteil hindurchfloss.
Doch die Umsetzung scheiterte an den Sachzwängen der Zeit. Der Bau der Berliner Mauer 1961 teilte die Stadt und führte zu plötzlichem Platzmangel. Aus ursprünglich geplanten 1.400 bis 1.500 Wohneinheiten wurden schließlich 19.000, viele davon in bis zu 30 Geschossen hohen Wohntürmen, was Gropius‘ grüner Stadtlandschaft entgegenstand. Obwohl Gropius zur Grundsteinlegung kam, blieb er bei der Fertigstellung außen vor und konnte am Endergebnis nichts ändern. Er wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, dass sein Name für die Stadt genutzt wurde, und war zutiefst darüber „erzürnt“, auch dass die Stadt nach seinem Tod seinen Namen erhielt.
Spätestens seit den 1980er-Jahren galt die Gropiusstadt als Problemviertel – zu viel Beton, dunkle Ecken, Anonymität. Es gab häufige Mieterwechsel und viel Leerstand, und die Gropiusstadt geriet wegen Verwahrlosung und Kriminalität in die Schlagzeilen. Viele Bewohner verstanden die negative Berichterstattung jedoch nicht und waren glücklich. Heute ziehen wieder Familien hierher, und Quartiersmanagement, Gemeinschaftsangebote und Sanierungen sollen den Stadtteil aufwerten. Die Utopie von damals bleibt jedoch eine „Dauerbaustelle“, ebenso wie die Suche nach einem besseren Leben für viele.
Bauhaus-Ideale weltweit: Lateinamerika als Gestaltungsfeld
In anderen Teilen der Welt besteht weiterhin ein großer Bedarf an „größeren Utopien“. Besonders in Lateinamerika besteht vor allem beim Wohnen und in der Infrastruktur in Großstädten großer Gestaltungsbedarf. Was Lateinamerika mit den Ideen des Bauhauses verbindet, ist die Vorstellung, dass der Architekt nicht nur Künstler, sondern vor allem der Gesellschaft verpflichtet ist. Es geht bei der Arbeit von Architekten und Stadtplanern um die Menschen.
• Kolumbien: Infrastruktur als sozialer Katalysator Die kolumbianische Großstadt Medellín stand vor großen Herausforderungen: verstopfte Straßen, ausufernde Favelas und ein unmöglicher Busverkehr in den schmalen, steilen Gassen. Die Stadt hatte eine Idee: Sechs Freiluft-Rolltreppen erleichtern nun den 384 Meter langen Aufstieg in entlegenste Bezirke und verbinden die Nachbarschaft, in der rund 140.000 Menschen leben. Die Kommune 13, die einst als das gefährlichste Stadtviertel der Welt galt und in Gewalt versank, hat sich durch diese Rolltreppen verändert. Sie ziehen Touristen an, wovon die Nachbarschaft profitiert, und lösen bei den Bewohnern ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Stolzes und des Glücks aus. Mehr als 30 Familien leben inzwischen von kleinen Geschäften an den Rolltreppen. Auch Gondeln auf der anderen Seite der Stadt machen die Favelas am Hang zugänglich. 2013 wurde Medellín sogar zur innovativsten Stadt der Welt gekürt. Doch hinter dieser „schönen Stadt“, die fotogen und freundlich erscheint, steckt eine Geschichte, die verschiedene Versionen hat: Hinter den beeindruckenden Infrastrukturprojekten steckt auch der Wunsch, die Stadt als Marke zu verkaufen, wobei die Bedürfnisse der Anwohner manchmal untergehen. Insgesamt drohen mehr als 600 Familien durch solche Projekte verdrängt zu werden, was die Frage aufwirft, ob die Stadt für Touristen oder für ihre Bewohner ist. Stadtplaner wie Carolina Salgado setzen sich dafür ein, dass Infrastrukturmaßnahmen vor allem das Leben der Menschen vor Ort verbessern.
• Mexiko: Soziales Wohnen und Hannes Meyers Erbe In Mexiko fanden die Visionen des Bauhauses bereits in den 1920er-Jahren erste Anhänger. Noch populärer wurde das Bauhaus, als sein zweiter Direktor, Hannes Meyer, 1939 einem Ruf der damals sozialistischen mexikanischen Regierung folgte und Direktor am neu gegründeten Institut für Stadtplanung in Mexiko-Stadt wurde. Obwohl Meyer in Mexiko keine Gebäude im klassischen Bauhaus-Stil hinterließ, beeinflusste er mit seinen Ideen eine ganze Generation mexikanischer Architekten, wie beispielsweise Mario Pani. Die Architektin Tatiana Bilbao beschäftigt sich mit sozialem Wohnungsbau, da die Wohnsituation in Mexiko äußerst kritisch ist mit hoher Nachfrage und großen Mängeln. Sie wollte eine Sozialwohnung entwerfen, die mehr bietet als die staatlich vorgeschriebene Mindestfläche von 43 Quadratmetern, da man mit 43 Quadratmetern „nichts anfangen kann“. Das Haus sollte flexibler und erweiterbar sein und sich an die klimatischen Bedingungen anpassen. Ähnlich wie bei Meyers Wohnungen in Dessau war es ihr wichtig, einen einfachen Grundtyp für ein überall reproduzierbares Haus zu entwerfen. Das mexikanische Modellhaus ist für die ärmsten Bevölkerungsteile gedacht und kostet in der günstigsten Variante, die von der Regierung bezuschusst wird, 8.000 Dollar. Der Kern besteht aus Betonblöcken, aber der Clou ist, dass das Haus mit flexiblen Modulen vergrößert werden kann. Angesichts des rasanten Bevölkerungswachstums in Mexiko könnte mit Bilbaos Häusern umgesetzt werden, was am Bauhaus noch eine Utopie war: mit Kreativität, Mut und guter Gestaltung ein gutes Leben für viele zu schaffen. Für Bilbao bedeutet das Bauhaus eine Vision von der Zukunft und die Vorstellung, wie Architekten einen Beitrag dazu leisten können.
• Yucatan: Tradition trifft Technologie – Inspiriert von Anni Albers Auch die Bauhäusler Josef und Anni Albers brachten die Ideen der Kunstschule nach Latein- und Südamerika. Anni Albers erlangte Bekanntheit durch ihren Vorkurs, den sie auf Reisen durch Mexiko, Kuba, Peru und Chile abhielt. In Mexiko war Anni Albers von Webtechniken und traditionellen Mustern begeistert, die sie später als Lehrerin am Black Mountain College weitergab, indem sie natürliche und industrielle Materialien verband. Die mexikanische Künstlerin Amor Muñoz ist von Anni Albers‘ Textilkunst inspiriert und gründete auf der Halbinsel Yucatan „Yucat“, ein Zukunftslabor für Technologie und Tradition in einem alten Maya-Dorf. Näherinnen, die zuvor in einer Textilfabrik arbeiteten und nach deren Schließung von ihrem Kunsthandwerk leben mussten, fertigen hier handgewebte Unterlagen aus Agavenfaser (Henequén). Diese sind mit leitendem Stahldraht und Solarpanelen verbunden, um elektrisches Licht zu spenden. Dieses Projekt, das auf Zusammenarbeit und Partizipation setzt, verbindet traditionelles Kunsthandwerk mit dem „Do-it-yourself-Spirit“ und dem Wissen über Solarenergie und LEDs. Es eröffnet ökonomische Zukunftsperspektiven, da neue Produkte auf dem Markt angeboten werden können. Amor Muñoz ist überzeugt, dass Technologie helfen kann, Kunsthandwerk und seine Traditionen zu bewahren, wenn die traditionelle Agavenfaser in Yucatan, die heute kaum noch angebaut wird, nicht in Vergessenheit geraten soll.
Bauhaus heute: Neue Herausforderungen, neue Antworten
Das Bauhaus war vor allem eine Schule, deren Ziel die Ausbildung eines „neuen Menschen“ war; deshalb hatte die Pädagogik einen besonderen Stellenwert. Diese Lehre ist bis heute lebendig und der Ausgangspunkt in der Ausbildung von Designern. Ein Beispiel ist die Deutsche Schule in Madrid, deren Architektur – gekennzeichnet durch Weißbeton, Glas und Aluminium – eine neue, aufgeschlossene Pädagogik unterstützt. Die Innenhöfe bestehen aus wabenartigen, miteinander verbundenen Einzelbaukörpern mit schützenden Nischen, und große Fenster öffnen den Blick auf die Landschaft, was zur Ruhe und Gelassenheit in der Bildung beiträgt. Das Gebäude inspiriert und stiftet Identifikation mit der Schule.
Die zentrale Frage des historischen Bauhauses – „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ – ist auch 100 Jahre später aktuell und wird heute weiter erforscht. Rasantes Städtewachstum, Überbevölkerung, zunehmender Platz- und Wohnungsmangel bei schwindenden Ressourcen sowie Klimawandel sind die Herausforderungen für die Gestalter von heute.
• Human Centered Design und Urban Farming in Detroit In Chicago, der Geburtsstadt der Wolkenkratzer, wurde 1937 das Institute of Design als „New Bauhaus“ gegründet. Der heutige Forschungsschwerpunkt ist „Human Centered Design“, das die Lebenswirklichkeit von Menschen gestaltet. Ein Beispiel ist das Projekt „Recovery Park“ in Detroit, wo auf alten Industriebrachen Gewächshäuser entstehen. In Detroit, wo die Automobilindustrie zusammenbrach und die Stadt 2013 den Bankrott erklärte, gibt es viel Platz in innerstädtischen Gebieten. „Recovery Park“ schafft Arbeitsplätze für Menschen, die schwer einen Job finden, wie ehemalige Häftlinge oder Suchtabhängige. Das Projekt bietet nicht nur Arbeit, sondern auch Ausbildung, Krankenversicherung und Unterstützung bei Unterkunft, Transport, Kleidung und Essen. Die Vision ist, das größte „Stadtfarming-Business“ der USA aufzubauen und Detroit als „Food City“ oder „Social City“ bekannt zu machen. Dies ist ein Beispiel für die „soziale Gestaltung von menschlichem Alltag“, die ebenfalls als Design verstanden wird.
• Grenzen der Architektur: Jürgen Mayer H. und das Skulpturale Bauen Der Berliner Architekt Jürgen Mayer H. liebt das Experiment und lotet die Grenzen der Architektur neu aus, indem er innovative Planung, neue Materialien und Konstruktionsmethoden nutzt, die organische und skulpturale Architekturen ermöglichen. Sein Metropol Parasol in Sevilla ist ein Beispiel dafür, der zum größten Holzbau der Welt wurde. Was zur Bauhaus-Zeit technisch undenkbar war, setzt Mayer H. heute in die Tat um: serielles und 3D-basiertes Bauen mit vorfabrizierten Elementen, die zugleich künstlerische Formen erlauben. Gropius experimentierte am Bauhaus mit neuen Materialien, doch die Formen waren damals noch gerade und rechteckig. Vielleicht, so wird spekuliert, sähe das Bauhaus heute so aus wie die Gebäude von Mayer H..
• Minimalismus und Nachhaltigkeit: Die Tiny House University Die Zeit des Überflusses ist vorbei; es zieht eine neue Zeit mit neuen Herausforderungen herauf. Nachhaltigkeit war etwas, das das Bauhaus durchaus auch beschäftigte, da es eine sehr arme Zeit war und sparsam mit Ressourcen und Materialien umgegangen werden musste. Statt „höher, schneller, weiter“ lautet das Motto der Tiny House University auf dem Gelände des Bauhaus-Archivs in Berlin: „verkleinert euch“. Dieses soziale Experiment, initiiert vom deutsch-russischen Architekten Van Bo Le-Mentzel, fragt, wie Räume ohne Grundstück geschaffen werden können. Die Mini-Häuser auf Rädern sind als Module konzipiert, leicht zu transportieren, einfach nachzubauen und recycelbar. Sie bieten flexible und günstige Wohnlösungen für digitale Nomaden. Dieses Konzept ist eine Antwort auf drängende Fragen wie Hunger, Wasser, Energie und Migration, die auf einem Campingplatz nicht gelöst werden können. Es steht für ein Umdenken weg vom Konsumieren hin zum Konstruieren. Das Bauhaus selbst fragte vor 100 Jahren, in einer Zeit des Systemwechsels von Monarchie zur Demokratie, wie eine Welt aussieht, in der alle gleiche Rechte haben, oder eine Wohnung, wo jeder eine Küche und einen Balkon verdient.
• Der Blick ins All: Norman Foster und Mars-Siedlungen Der britische Architekt Sir Norman Foster, einer der bekanntesten Architekten der Gegenwart, entwirft sogar Häuser für den Mars. Sein Projekt mit der NASA erforscht, was aus dem auf dem Mars vorgefundenen Material gebaut werden kann – Roboter mischen den roten Marssand mit einem Zusatzstoff, um Schalen zu bauen, die auf Knochenstrukturen von Tieren und Menschen basieren. Dies ist notwendig, da es nicht effizient ist, Stahlträger und Dämmstoffe in großen Mengen ins All zu fliegen. Diese „kühne und radikale“ Idee, neue Planeten zu erschließen, steht im Einklang mit der menschlichen Natur, immer höher anzustreben und Grenzen zu überschreiten. Dennoch wird betont, dass es vernünftiger ist, zunächst die Dinge auf der Erde in Ordnung zu bringen und das Leben der vielen in den Blick zu nehmen.
Eine anhaltende Vision für die Zukunft
Die Quellen zeigen, dass die Ideale des Bauhauses 100 Jahre später sogar relevanter sind als sie es damals waren. Wir brauchen einfallsreiches Design, um die großen Herausforderungen unserer Zeit wie rasantes Städtewachstum, Umweltverschmutzung und Klimawandel zu bewältigen. Das Bauhaus hatte eine „sehr optimistische, sehr utopische und gleichzeitig bodenständige Auffassung von Design im weitesten Sinne“. Bei der Arbeit von Architekten, Designern und Stadtplanern geht es um Lebensqualität. Die feste Überzeugung ist, dass sich die Qualität des Lebens verbessert, wenn die Qualität des Designs verbessert wird. Niemand weiß, wie die Zukunft aussehen wird, aber wir werden sie gestalten – denn die einzige Konstante ist die Veränderung.