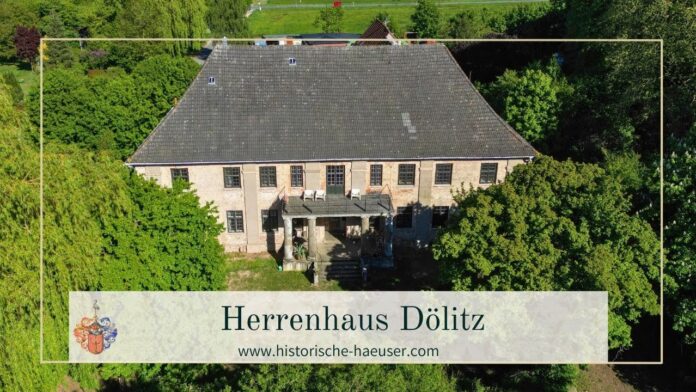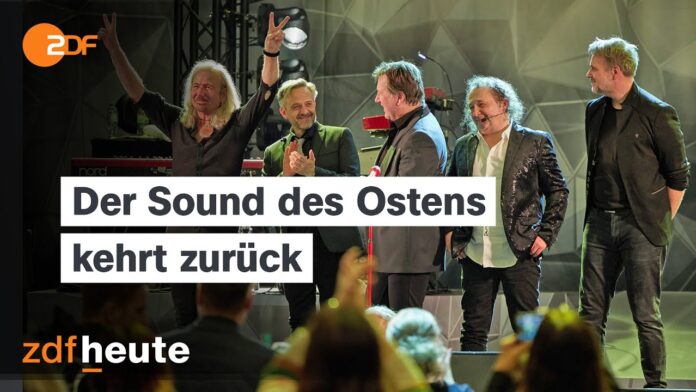Zwickau – Fast fünf Jahre intensiver Arbeit, unzählige ehrenamtliche Stunden und die Zusammenarbeit zahlreicher Enthusiasten, Institutionen und Unternehmen finden ihren Höhepunkt: Auf einer Pressekonferenz in Zwickau wurde kürzlich ein ganz besonderes Stück Automobilgeschichte präsentiert – ein Trabant mit einem experimentellen Wankelmotor, liebevoll „Felix“ genannt. Dieses Fahrzeug ist nicht nur ein restaurierter Prototyp, sondern ein lebendiges Zeugnis des Innovationsgeistes der DDR-Automobilentwicklung und der tief verwurzelten Tradition des Fahrzeugbaus in der Region Zwickau.
Die Geschichte des Wankel-Trabants reicht zurück in die 1960er Jahre. Von 1962 bis 1969 beschäftigte sich die Versuchsabteilung im VEB Sachsenring mit dem Kreiskolbenmotor. Die Idee war, einen Nachfolger für den Zweitaktmotor des Trabant 601 zu entwickeln, der für ein geplantes Heckmotor-Fahrzeug, das spontan als „Trabant 603“ oder auch als „Golf der DDR“ bezeichnet wurde, vorgesehen war. Für die Fahrversuche wurde ein straßentaugliches Fahrzeug, der Trabant 601, als Träger für verschiedene Wankelmotor-Varianten genutzt.
Das nun präsentierte Fahrzeug, intern VT 0072 genannt, ist ein Original-Versuchsfahrzeug, das 1966 gebaut wurde und 1966/67 100.000 Kilometer Dauerlauferprobung auf der Sachsenring Erzgebirgsstrecke absolvierte. Christian Meichner fuhr das Auto damals oft und war maßgeblich daran beteiligt. Später wurde dieses spezifische Testfahrzeug an einen Betriebsangehörigen verkauft und auf den Serien-601-Motor zurückgerüstet.
Das Projekt zur Wiederbelebung von „Felix“ begann, als den Beteiligten ein solches Auto in die Hände fiel und die Frage aufkam, was damit geschehen sollte. Man entschied sich, das V72 Projekt wieder aufleben zu lassen. Dies war jedoch keine einfache Aufgabe, da von den ursprünglich etwa 100 gebauten Wankelmotoren kaum noch etwas existierte und auch die Dokumentation schwer zu finden war. Die Trabantfreunde Hans Luck und Wolf Lorenz leisteten umfangreiche Recherchen und entdeckten schließlich im Stadtarchiv Chemnitz die entscheidenden Unterlagen zum VT 0072.
Der Karosserie und das Fahrwerk des nun fertiggestellten Fahrzeugs sind nach Angaben der Projektverantwortlichen zu schätzungsweise 90 % original und authentisch. Auch wenn einige Teile fehlten und ersetzt werden mussten, „dieses Auto hat schon gelebt“, betonte einer der Beteiligten. Der heute eingebaute Wankelmotor ist zwar nicht exakt derselbe, der damals die Dauerläufe bestritt, aber ebenfalls ein Original. Er wurde 1977 speziell für den Trabant gebaut und fand sich im Keller des Museums. Von diesem Motortyp gab es nur zwei Exemplare, eines wurde dankenswerterweise für das Projekt zur Verfügung gestellt. Dieser Motor war ebenfalls schon gelaufen, wahrscheinlich auf einem Prüfstand.
Die Aufarbeitung des Motors übernahm die Wankelag in Fürchberg. Obwohl er gebraucht, aber in sehr gutem Zustand war, wurde er überholt. Die Karosserie wurde nach Werdau zur Lackierung gebracht, wobei die Originalfarbe ermittelt werden konnte. Unternehmen wie Indica (Scannen), die Hochschule (Zeichnungen) und Webero (Zerlegung/Teile) unterstützten das Projekt. Frieder Meichner, Bruder von Christian Meichner, und Ar Funke investierten ebenfalls viel Zeit in den Aufbau. Sogar ein Firmelektriker war beteiligt, um die Elektrik, einschließlich der damals getesteten 12V Drehstromlichtmaschine, zu realisieren. Auch die Duplexbremse, die erst später im Serien-Trabant eingeführt wurde, konnte anhand historischer Dokumente in das Fahrzeug integriert werden.
Das August Horch Museum und Intertrab waren maßgeblich an der Umsetzung beteiligt. Der MDR begleitete das Projekt filmisch von Anfang an. Finanzielle Unterstützung kam vom Kulturraum Zwickau und der Stadt Zwickau. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro, wobei die unzähligen ehrenamtlichen Stunden nicht eingerechnet sind. Ohne die freiwillige Arbeit und Preisnachlässe wäre das Projekt kaum realisierbar gewesen.
Warum der Wankelmotor damals so interessant war, erklärte ein Experte auf der Konferenz: Er versprach bei kleinem Bauraum, geringem Gewicht und weniger beweglichen Teilen eine extrem hohe Leistung. Man erhoffte sich Vorteile sowohl im Betrieb als auch in der Herstellung. Weltweit gab es in den 60er Jahren einen „Hype“ um den Wankel. Im Sachsenring wurden vier verschiedene Wankelmotoren entwickelt. Dennoch schaffte es der Motor in der DDR nicht zur Serie. Gründe dafür waren technische Herausforderungen wie die komplizierte Abdichtung und aufkommende Umweltauflagen bezüglich Emissionen. Ein weiterer wichtiger Faktor in der DDR waren die begrenzten wirtschaftlichen Fähigkeiten und die Zulieferindustrie, die mit der Umstellung von einem einfachen luftgekühlten Zweitakter auf einen wassergekühlten Wankel überfordert gewesen wären.
Der im „Felix“ verbaute Motor war auf 35 PS projektiert. Andere bei Sachsenring entwickelte Motoren mit 450 cm³ Kammervolumen leisteten auch 50 PS. Zum Vergleich wurde erwähnt, dass ein normaler Serien-601-Motor und ein aufgeschnittener Kreiskolbenmotor im Museum zu sehen seien, um das Prinzip zu verdeutlichen.
Die Beteiligten zeigten sich sichtlich stolz auf das fertiggestellte Projekt, das ein einzigartiges Original darstellt. Es ist ein wichtiges Zeugnis der Automobil- und Industriegeschichte Sachsens und trägt zur Traditionspflege bei. Es zeigt die „wirklich tolle[n] Leute, die was wollten, die was konnten“ in der DDR, aber auch die „sehr begrenzten Möglichkeiten“ und das „legendäre Improvisieren“.
Nach der Pressekonferenz hatten die Anwesenden die Möglichkeit, das Fahrzeug im Hof in Augenschein zu nehmen. Geplant ist auch, den Trabant „Felix“ in Zukunft öffentlich zu präsentieren und zu fahren, um dieses besondere Stück Geschichte lebendig zu halten.