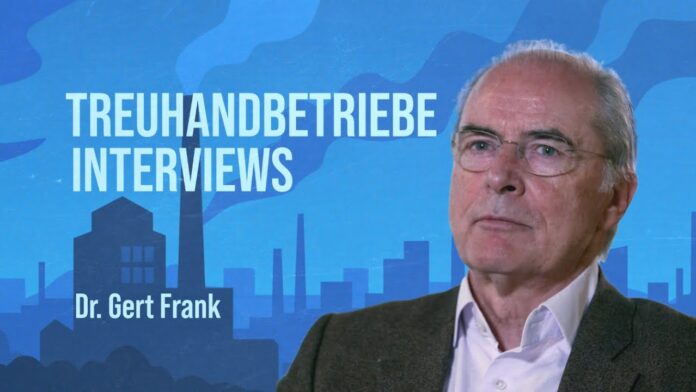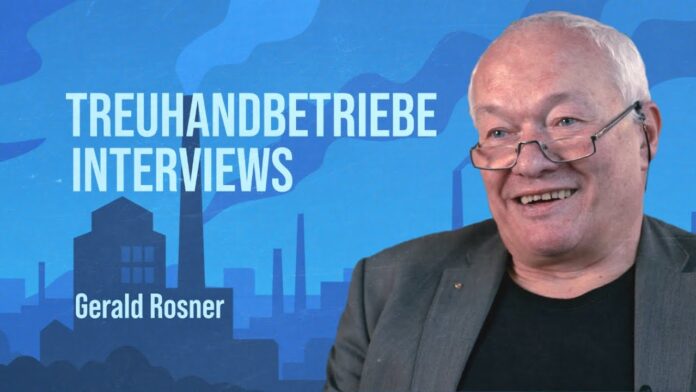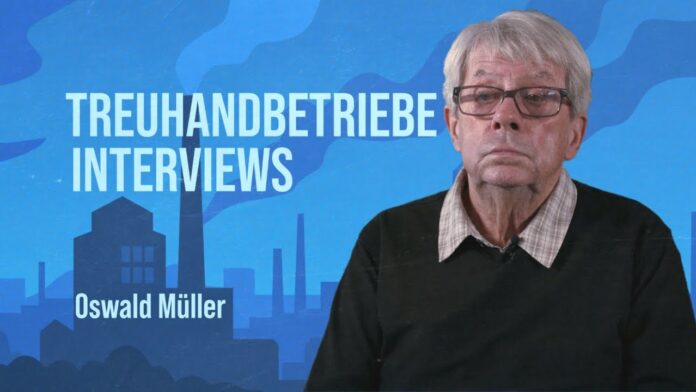Die Zeit der Wende war eine Phase des Umbruchs und der Unsicherheit, besonders für Betriebe in der ehemaligen DDR. Mittendrin im Geschehen in Greifswald fand sich Walter Kienast, damals Mitglied der Betriebsleitung des heutigen Unternehmens Greifenfleisch, wieder. Sein Weg vom Betriebsleiter zum Treuhand-Geschäftsführer und schließlich zum Unternehmer war geprägt von Herausforderungen, persönlichen Opfern und einem unerschütterlichen Willen.
Bevor die Wende kam, steckte Greifenfleisch, damals noch ein DDR-Betrieb, mitten in Investitionsvorbereitungen. Rund zweieinhalb Millionen DDR-Mark waren bereits für Technologie ausgegeben worden. Ein benachbartes Grundstück, auf dem zuvor die GST war, wurde geräumt. In dieser Phase erlebte Walter Kienast, der jüngste in der 13-köpfigen Betriebsleitung, auch Konflikte mit der Kreisleitung der Partei. Deren Vorstellungen vereinten sich oft nicht mit seinem fachlichen Dasein. Er sollte Berichte schreiben, die nicht der Wahrheit entsprachen und Probleme leugneten. Kienast lehnte Gespräche mit derartigen Leuten ab und forderte fachliche Gesprächspartner. Rückblickend war er froh über die Wende.
Im März 1990 erhielt Kienast ein Schreiben vom Rat des Bezirkes, der im Auftrag der Treuhand handelte, mit der Aufforderung, einen vorläufigen Geschäftsführer zu benennen. Kienast und seine Frau hatten zu diesem Zeitpunkt entschieden, nach Rostock zurückzukehren. Er forderte die anderen Betriebsleitungsmitglieder auf, sich zu entscheiden, da auch sie ihre Arbeitsplätze behalten wollten. Obwohl es in dieser Phase Leute gab, die „große Klappe hatten“ und forderten, dass ehemalige Stasi-Mitarbeiter gehen sollten, wurde Kienast nach eigener Aussage nie direkt von Mitarbeitern angegriffen. Er erklärte, freiwillig auszusteigen.
Die Wende nahm eine unerwartete Wendung für Walter Kienast. Er versuchte zunächst, andere Betriebsmitglieder zu bewegen, sich zu melden, obwohl er selbst nicht davon überzeugt war. Bei einer Sitzung demonstrierte er, dass sie ab 17 Uhr führungslos wären, indem er seinen Platz am Kopfende verließ. Doch dann wurde er vermehrt von Mitarbeitern angesprochen, die besorgt waren, dass alles den Bach runtergehen würde, wenn er ginge. Seine Frau, eine Kindergärtnerin, hatte viele Eltern vom Schlachthof in ihrer Gruppe. An einem Samstagabend, nachdem sie auf dem Markt erneut von Mitarbeitern angesprochen wurden, sagte seine Frau zu ihm: „Du, so wie wir beide seelisch gestrickt sind, wenn du jetzt hier aus Kreiswald oder wir aus Kreiswald weggehen und du den Betrieb nicht weiterführst und er geht den Bach runter, dann werden wir beide unser Leben lang nicht richtig glücklich, weil wir immer Schuldgefühle mit uns tragen“. Diese Einsicht, die Kienast so vorher noch nicht gesehen hatte, war ausschlaggebend. Er beschloss, seinen Namen zu melden, wohlwissend, dass es keine leichte Zeit werden würde, da niemand wusste, was bevorstand.
Der Betrieb wurde zur GmbH i.A. (im Aufbau). Es brauchte einen Namen. Kienast suchte einen kurzen, knackigen Namen für das Marketing. Er wollte etwas für Greifswald tun. Inspiriert von lokalen Namen wie „Greifenhandel“ und „Greifengalerie“, entschied er sich für „Greifenfleisch“.
Die Anfangszeit war schwierig. Kienast setzte zunächst auf Vertrauen und belud Kühlfahrzeuge mit Produkten wie Bierschinken, Jagdwurst und Kochschinken. Ältere Kraftfahrer über 55 Jahre erhielten die Verantwortung für die Ladung und mussten nur Lieferscheine schreiben. Diese Fahrer berichteten jedoch von geringem Absatz in Greifswald und Umgebung. Die Kunden kauften nichts ab, weil sie sich erinnerten, wie Herr Kienast früher rationiert hatte und sie nicht genug Kochschinken, Filets oder Grillartikel bekamen. Sie wollten ihm zeigen, „wer der Herr im Staate ist“. Zudem dominierten nun bunt verpackte SB-Verpackungen aus dem Westen, und viele empfanden die westliche Wurst – zumindest am Anfang – als besser.
Kienast suchte proaktiv den Kontakt zu Kaufhallendirektoren und Abteilungsleitern. Er erklärte ihnen, dass er früher nur der Verteiler war und der Verteilungsschlüssel feststand: Zuerst wurde das Kernkraftwerk (KKW, heute Siemens) versorgt, dann die Stadt und die Universität als die drei Hauptbetriebe. Was übrig blieb, ging an die Kaufhallen, und Reste an die Konsumbetriebe. Es gab auch feste Anordnungen für Lieferungen nach Rostock und an die Markthalle in Berlin. Seine Devise war von Anfang an Profitabilität. Zusammen mit einem erfahrenen kaufmännischen Leiter kalkulierten sie intensiv, manchmal bis Mitternacht. Sie setzten Preise fest, die marktfähig waren und gleichzeitig eine profitable Produktion ermöglichten. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die Preise blind unterboten, kalkulierte Greifenfleisch genau und machte tatsächlich vom ersten Monat an Gewinn.
Eine Altlast aus DDR-Zeiten war ein buchhalterischer Verlustvertrag von rund 2 Millionen. Dieser wurde sorgsam gehütet, da er es erlaubte, Gewinne steuerfrei mit den Schulden zu verrechnen. Die Treuhand erließ diese Schulden zunächst nicht. Die Gewinne wurden genutzt, um diesen Verlustvertrag abzuschreiben. Unabhängig davon machte das Unternehmen mit jedem verkauften Stück Wurst Gewinn. Dies ermöglichte es Greifenfleisch, die ersten benötigten Verpackungsmaschinen selbst zu kaufen. Kienast wollte diese Investitionen nicht über Treuhandgelder finanzieren, da er Probleme bei der späteren Privatisierung sah.
Die Zusammenarbeit mit der Treuhand war nicht einfach. Kienast durfte bestimmte Verträge, wie Mietverträge, nicht selbst unterzeichnen; sie benötigten eine Gegenzeichnung der Rechtsabteilung in Rostock. Diese Genehmigungen dauerten bis zu einem Vierteljahr, wodurch Geschäfte verloren gingen. Kienasts Lösung war die Einführung eines Aufsichtsrates, dessen Vorsitzender alle Kompetenzen der Treuhand erhielt, mit Ausnahme der Privatisierung. Dies machte den Betrieb ab Anfang 1990 überhaupt erst lebensfähig. Hätte jemand entdeckt, dass Kienasts eigene Vertragsunterschriften nichtig waren, hätten sie von heute auf morgen weggewiesen werden können. Durch den Aufsichtsratsvorsitzenden konnten Verträge schnell, teils telefonisch, genehmigt werden.
Mitten in dieser Phase des Aufbaus gab es auch Rückschläge von außen. Jemand aus einer anderen Wurstfabrik soll beauftragt haben, Zigarettenkippen in Fleischkisten zu werfen und ein Streichholz in Wurst zu drücken. Dies wurde fotografiert, und Greifenfleisch wurde daraufhin als Lieferant abgelistet. Kienast musste sich rechtfertigen und wies darauf hin, dass dies technisch bei ihnen kaum möglich sei, es sei denn, es war eine geplante Sabotage. Die „Beweise“ sprachen jedoch gegen ihn. Etwa acht Wochen später meldete sich jedoch die Person, die die Fotos gemacht hatte, vom schlechten Gewissen geplagt, und gestand, dass nicht Greifenfleisch verantwortlich war, sondern er von jemand anderem dazu veranlasst wurde. Dies klärte die Situation, und Greifenfleisch durfte wieder liefern. Kienasts Devise blieb: „Lass doch die Kunden entscheiden“. Gab es anfangs noch acht Wurstproduzenten in Greifswald, ist Greifenfleisch heute der einzige. Der Erfolg liege in Geschmack, Qualität und Produkten, die andere nicht wollen oder können. Sie kombinieren moderne Maschinen mit Handwerksarbeit.
Der Prozess der Privatisierung selbst war chaotisch. Kienast erlebte, wie sein Betrieb verkauft wurde, ohne dass die zuständigen Treuhand-Mitarbeiter die notwendigen Unterlagen wie Konzepte dabeihatten oder den Betrieb kannten. Auf die Frage nach der gesetzlich vorgeschriebenen Kommission aus Vertretern von Gewerkschaften, Neuem Forum, Parteien, IHK etc., die bei der Vergabe hätte dabei sein müssen, erhielt er die Antwort, dass dies in keiner Kommission verhandelt worden sei. Daraufhin verlor Kienast die Fassung. Der Privatisierungsdirektor erklärte ihm, dass es „erledigt“ sei und „keiner mehr kauft, keiner mehr bietet“. Kienast wies darauf hin, dass niemand kaufen könne, der sich gar nicht beworben habe. Dies wurde abgetan mit der Bemerkung, das sei nicht seine Sache und er habe sowieso kein Geld. Kienast verteidigte seine Fähigkeit, den Betrieb zu führen, indem er auf die erfolgreiche Sanierung des DDR-Betriebs und den aktuellen guten Kontostand verwies.
Nach dieser fragwürdigen Vergabe begann das „Gezähre“ um Greifenfleisch erneut. Kienast schrieb einen Brief an Frau Breuel. Er wählte den Weg über den Ministerpräsidenten, da bekannt war, dass viele Briefe an Frau Breuel abgefangen wurden. Frau Breuel setzte sich ein und sprach in Rostock Klartext, was später vom Leiter der Treuhand bestätigt wurde. Dies führte zu einem sechsten Ansprechpartner von den Privatisierern. Nach anfänglichen Streitigkeiten lud Kienast ihn nach Greifswald ein, um sich Betrieb und Ergebnisse anzusehen. Nachdem der Mann Kienasts Führungsfähigkeit infrage stellte, drohte Kienast, die Unterlagen ein letztes Mal nach Berlin schicken zu lassen, damit die Privatisierung von dort erfolgte. Daraufhin wurde der Mann um seinen Job bange und schlug in Greifswald eine schnelle Lösung vor: Kienast sollte sein Konzept erneut einreichen, und die Treuhand würde es europaweit mit der kürzesten Frist (sechs Wochen) ausschreiben. Er versprach, dass kein Angebot ohne Konzept angenommen würde.
Ende November, nach vierstündiger Prüfung der materiellen Grundwerte, wurde ein Kaufpreis von 2,5 Millionen Euro festgelegt. Kienast hielt diesen für viel zu hoch. Die Dresdner Bank war jedoch bereit, dies zu finanzieren, sogar mehr Geld zu geben, als eigentlich benötigt wurde. Die Kredite waren staatlich verbürgt. Obwohl der Preis zu hoch war, wurde unterschrieben. Neben dem Kaufpreis von 2,5 Millionen Euro wurden dem Betrieb auch noch 1 Million Euro Altkredite aus DDR-Zeiten auferlegt (von ursprünglich 3,5 Millionen wurden 2,5 Millionen erlassen).
Erst Jahre später, als Investitionen getätigt und die Wurstfabrik aufgebaut waren, wurde Kienast bewusst, dass der hohe Kaufpreis das Problem war, nicht die mangelnde Marktfähigkeit des Unternehmens. Dies wurde durch Wirtschaftsprüfer untersucht und bestätigt. Daraufhin gab es in den Jahren 2002 oder 2003 eine Teilentschuldung. Erst seitdem fühlte sich Walter Kienast richtig als Unternehmer, zuvor war er „nur der Knecht der Bank“. Diese Entlastung ermöglichte es ihm, auch mehr für die Mitarbeiter zu tun.
Walter Kienast blickt auf diese Zeit zurück und reflektiert, wie manches besser hätte laufen können. Er kritisiert, dass die Außenstellen der Treuhand oft allein gelassen wurden. Er geht davon aus, dass sehr viele Schmiergelder flossen. Ein Privatisierungspartner sei nach eigener Aussage entlassen worden, weil er sein Schmiergeld mit dem Falschen geteilt habe. Es hätten Kontrollmechanismen eingesetzt werden müssen. Trotz des hohen Erwartungsdrucks hätten mehr Betriebe überleben können, wenn genauer hingesehen und befähigte Leute eingesetzt worden wären. Viele seien „Glücksritter“ gewesen, die sich eine „goldene Nase“ verdienten und wohl auch bei Zuschlägen die Hand aufhielten.
Trotz der Schwierigkeiten ist Walter Kienast sehr stolz auf die Firma, das Erreichte und seine Familie. Seine Frau und Tochter haben über die Jahre auf viel Freizeit verzichtet. Er gibt offen zu, dass er diesen schweren Weg nicht gegangen wäre, wenn er vorher gewusst hätte, wie hart es werden würde, aber eine starke Frau im Rücken machte es möglich. Er ist stolz auf das Erreichte und mit sich im Reinen. Die Fabrik läuft unter seinen Nachfolgern auf dem von ihm aufgebauten Niveau weiter. Der Umsatz ist heute sogar besser als zu der Zeit, als er ging. Die Geschichte von Greifenfleisch ist ein Beispiel für die turbulenten Jahre der Wende, die Herausforderungen der Privatisierung und den Durchhaltewillen eines Unternehmers und seiner Familie.