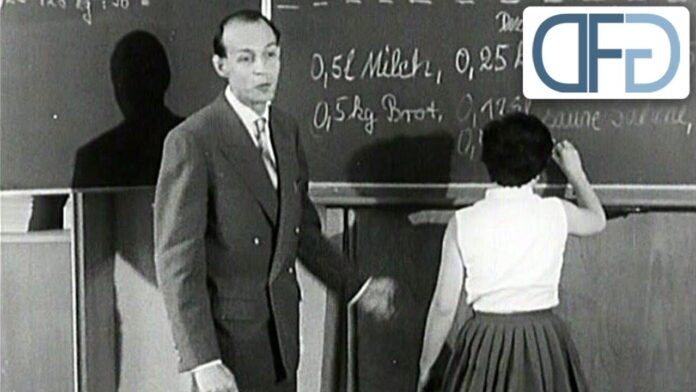Bonn, 1959 – Vierzehn Jahre nach Kriegsende präsentiert sich die Bundesrepublik Deutschland als eine beachtliche Industriemacht mit Weltgeltung, stolz auf den Wiederaufbau und schicke Autos. Doch hinter der glänzenden Fassade des wirtschaftlichen Aufschwungs verbirgt sich ein alarmierender Missstand: das deutsche Bildungssystem gleicht vielerorts noch einem Trümmerhaufen. Die geforderte „kulturelle Aufrüstung“ ist bislang largely nur auf dem Papier existent, und die Probleme der Nachwuchsbildung werden im Bundestag zwar diskutiert, die Realität in Schulen und Hochschulen bleibt jedoch ernüchternd.
Schulen: Überfüllte Klassen und veraltete Gebäude
Ein Blick in viele Schulen offenbart ein düsteres Bild. Die meisten Gebäude stammen noch aus der Jahrhundertwende, viele wurden im Krieg zerstört und nur notdürftig oder gar nicht wieder aufgebaut. Es ist keine Seltenheit, dass ein vielversprechendes Portal in eine „Schulruine“ führt.
Die Zustände sind gravierend:
• Veraltete Infrastruktur: Turnhallen sind oft alte Gasthöfe, auf deren Wänden sich Inschriften von „Lustbarkeiten verschiedener Vereine“ finden, mit Bierhähnen vorne und Boxsäcken hinten. Nasse Mauern verbreiten modrigen Geruch. Toiletten sind oft vom Übel. Moderne, hygienische Toiletten sind die Ausnahme.
• Überbelegung der Klassen: Schulbänke, die noch aus der Jugendzeit der Großväter stammen, sind die Norm, und Klassen sind mit 50 Schülern überfüllt. Experten betonen, dass die ideale Klassengröße bei 25 bis 30 Schülern läge, um eine moderne Unterrichtsgestaltung zu ermöglichen und bessere Lernergebnisse zu erzielen.
• Schichtunterricht: Ein alarmierender Zustand, der an Volks- wie auch Gymnasien weit verbreitet ist, zwingt Schüler dazu, erst am Nachmittag mit dem Unterricht zu beginnen. Dieser Missstand soll voraussichtlich erst zweieinhalb Jahre später behoben sein, wenn genügend neue Schulen gebaut wurden – 16 Jahre nach Kriegsende.
• Fehlende Räume: Insgesamt fehlen in der Bundesrepublik 63.000 Klassenräume. Allein die Einführung des 9. und 10. Schuljahres sowie die Senkung der Schülerzahl pro Klasse würden zehntausende zusätzliche Räume erfordern.
Das Problem des Lehrermangels und die Arbeitsbedingungen
Trotz einer wesentlichen Verbesserung der Lehrerbesoldung in den letzten Jahren – ein junger Volksschullehrer verdient 1959 netto 711 Mark, seine Frau als Lehrerin 650 Mark – herrscht ein massiver Lehrermangel. Die Zahlen sind erschreckend: 7.000 Lehrer fehlen im jetzigen Zustand, und durch die Einführung weiterer Schuljahre und die Senkung der Klassengrößen steigt dieser Bedarf auf insgesamt 108.000 fehlende Lehrer.
Die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte sind oft unzureichend:
• Überfüllte Lehrerzimmer: Die Lehrerzimmer sind viel zu klein, bieten keine Möglichkeit zur Konzentration oder Vorbereitung.
• Mangelnde Ausstattung: Bibliotheks- oder Aufenthaltsräume fehlen.
• Hohe Arbeitsbelastung: Ein Volksschullehrer unterrichtet gewöhnlich sechs Stunden pro Tag, was nach der vierten Stunde zu einem Spannkraftverlust und der Gefahr des Routineunterrichts führt. Hinzu kommen Korrekturen, Unterrichtsvorbereitung, Weiterbildung und Elternbesprechungen, die leicht zu einer 56-Stunden-Woche führen. Idealerweise sollte die wöchentliche Unterrichtszeit von 30 auf 24 Stunden reduziert werden, was immer noch 47 Arbeitsstunden pro Woche bedeuten würde.
Hochschulen: Massenbetrieb und desolate Zustände
Auch an den Universitäten und Ingenieurschulen ist die Lage prekär. Die Studentenzahlen sind seit 1930 von 72.800 auf 167.000 im Jahr 1959 gestiegen. Dies führt zu einer „Notlage, die durch das Missverhältnis der Zahl der Studierenden zu den Dozierenden sowie durch den Mangel an Raum charakterisiert ist“.
Die Probleme im Hochschulbereich sind vielfältig:
• Überfüllte Hörsäle und Labore: Eine Aula, die für 750 Studenten ausgelegt ist, ist mit 1000 Studenten überfüllt. Laborräume, die noch aus dem Ersten Weltkrieg stammen, sind alt, abgenutzt, und Studenten arbeiten unter tropfenden Rohren in Kellerräumen.
• Desolates Betreuungsverhältnis: Auf einen Dozenten kommen durchschnittlich 20 Studenten, in den Sozialwissenschaften kann das Verhältnis aber bei 1 zu 100 liegen. Ein Assistent betreut bis zu 27 Studenten, obwohl 10 bis 12 Studenten pro Assistent wünschenswert wären.
• Raummangel und Studienplatzknappheit: Von 350 interessierten Studenten konnten in einem pharmazeutischen Institut nur 40 angenommen werden. An Ingenieurschulen werden von 100 Aspiranten, die die Aufnahmeprüfung bestehen, nur 30 aufgenommen.
• Finanzielle Nöte der Studenten: Viele Studenten wohnen weit entfernt und müssen lange pendeln, da Studentenbuden in der Stadt zu teuer sind oder sich in „wenig Vertrauen erweckenden Gebäuden“ befinden. Viele sind auf Stipendien angewiesen, die oft nicht ausreichen, oder müssen über den studentischen Schnelldienst Arbeit suchen, um Miete, Bücher oder Freizeitaktivitäten zu finanzieren.
Lösungsansätze und der Blick in die Zukunft
Zwar gibt es neue, moderne Schulbauten und pharmazeutische Institute, die zeigen, was möglich wäre, wenn die notwendigen Mittel bereitgestellt würden. Der Zustrom an die Pädagogischen Institute hat sich in den letzten fünf Jahren von 450 auf 1350 Studierende erhöht, was als „sehr erfreuliche Sache“ im Angesicht des enormen Lehrerbedarfs gilt.
Ein revolutionärer Reformplan für die Volksschule, der eine vierklassige Grundschule und verschiedene weiterführende Schulformen vorsieht, scheitert jedoch vorläufig am Raum- und Lehrermangel.
Der Ruf aus der Industrie wird lauter: Generaldirektor Dr. Hermann Reusch vom Bundesverband der deutschen Industrie betont, dass Wissenschaft und Bildung zu einem Politikum ersten Ranges geworden sind und der Leistungsfähigkeit von Schulen und Hochschulen die „oberste Dringlichkeitsstufe aller geistigen und finanziellen Anstrengungen“ gebührt. Einige Firmen greifen bereits zur Selbsthilfe und bieten ihren Lehrlingen nicht nur Fachausbildung, sondern auch Unterricht in allgemeinbildenden Fächern an, da sie mit der Leistung der Schulen nicht zufrieden sind.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im Vergleich zur Sowjetunion (280 Universitätsingenieure pro Million Bevölkerung) und den USA (136) liegt Westeuropa mit 124 Ingenieuren pro Million deutlich zurück. Ähnlich verhält es sich bei der Studentenzahl pro 1000 Einwohner: fast drei in der Sowjetunion, aber nur einer in der Bundesrepublik.
Die Erkenntnis, dass das Problem der „Vermassung“ an den Universitäten in seiner ganzen schwerwiegenden Tragweite erkannt werden muss, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschaft zu erhalten und den Nachwuchs zu sichern, scheint angekommen. Es bleibt jedoch die dringende Aufgabe, die „kulturelle Aufrüstung“ nicht nur auf dem Papier zu fordern, sondern sie auch in der Realität umzusetzen, denn der „Kalte Krieg im Klassenzimmer“ ist ein Kampf um die nationale Existenz.