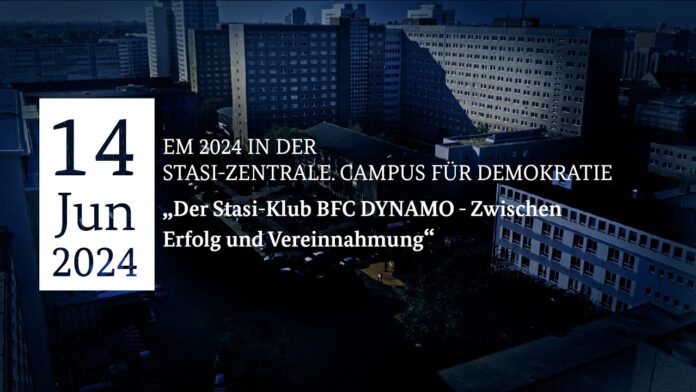Wir werfen mit unseren Gästen einen Blick auf den Fußball in der DDR, das System der Dynamo-Vereine und die Sonderstellung des BFC Dynamo und sprechen über die Fankultur des Vereins in den 1980er Jahren.
Gespräch mit:
Jutta Braun, Historikerin am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam
René Lau, BFC-Fan der frühen Stunde und inzwischen auch Rechtsanwalt des BFC Dynamo
Moderation: Dagrun Hintze, Fußballkolumnistin und Theaterautorin
Der Berliner Fußballclub Dynamo (BFC Dynamo), gegründet 1966, war der Vorzeigeklub der DDR und galt als das Symbol der engen Verflechtung von Sport und Politik im sozialistischen Staat. Unter dem Schutz und der Förderung des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi), insbesondere durch den damaligen Stasi-Chef Erich Mielke, wurde der BFC Dynamo in den 1970er und 1980er Jahren zum erfolgreichsten Fußballverein der DDR. Mielke, ein glühender Fußballfan, sah in dem Verein ein Instrument der politischen Propaganda und der Kontrolle.
Der BFC Dynamo dominierte die DDR-Oberliga, die höchste Spielklasse im DDR-Fußball, von 1979 bis 1988 und gewann zehn Mal in Folge die Meisterschaft. Dieser Erfolg war nicht nur das Ergebnis sportlicher Leistung, sondern auch eines Systems, das dem Verein erhebliche Vorteile verschaffte. Dazu gehörten gezielte Spielermanipulationen, bei denen talentierte Spieler aus anderen Vereinen zum BFC transferiert wurden, oft gegen ihren Willen. Der Verein konnte zudem auf erstklassige Trainingsbedingungen und die besten Talente des Landes zurückgreifen.
Dieser unfaire Vorteil führte dazu, dass der BFC Dynamo bei vielen Fußballfans in der DDR äußerst unbeliebt war. Der Klub wurde häufig als „Stasi-Klub“ oder „Schiebermeister“ bezeichnet, und Spiele des BFC wurden von heftigen Anfeindungen und Beschimpfungen begleitet. Der Klub galt als Inbegriff des ungerechten Systems, das die DDR durchzog, und viele sahen in ihm eine Verkörperung der staatlichen Unterdrückung und Manipulation.
Auch Schiedsrichterentscheidungen zugunsten des BFC Dynamo sorgten immer wieder für Kontroversen. Es gibt zahlreiche Berichte und Anekdoten über manipulierte Spiele, bei denen Schiedsrichter offenbar unter Druck gesetzt wurden, Entscheidungen zugunsten des BFC zu fällen. Diese Vorgänge trugen weiter zur negativen Wahrnehmung des Vereins bei und festigten seinen Ruf als „Stasi-Klub“.
Nach dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 verlor der BFC Dynamo seine privilegierte Stellung und geriet schnell in sportliche und finanzielle Schwierigkeiten. Ohne die Unterstützung durch die Stasi und den Staat konnte der Verein nicht mehr an seine früheren Erfolge anknüpfen. Der BFC stieg in den Amateurbereich ab und kämpft seitdem um seinen Platz im deutschen Fußball.
Heute ist der BFC Dynamo vor allem ein Stück deutscher Fußballgeschichte und ein Mahnmal für die Verstrickung von Sport und Politik in der DDR. Die Geschichte des Klubs verdeutlicht, wie Sport im Ostblock für politische Zwecke instrumentalisiert wurde und welche Schattenseiten der Erfolg unter einem solchen System mit sich brachte.