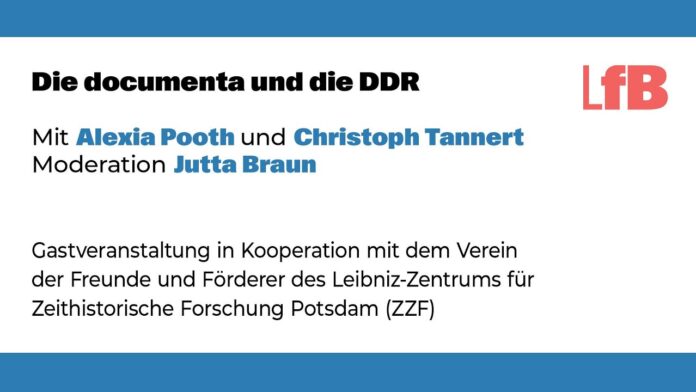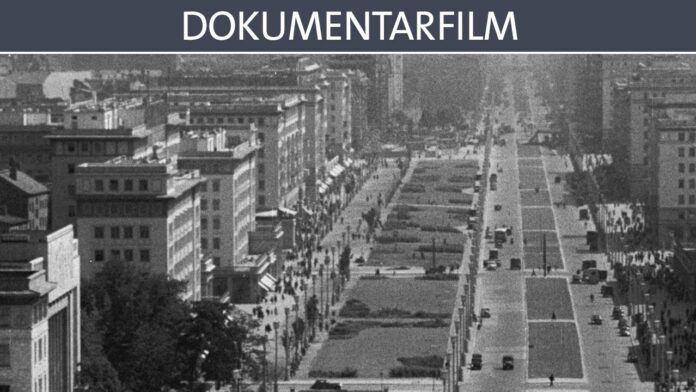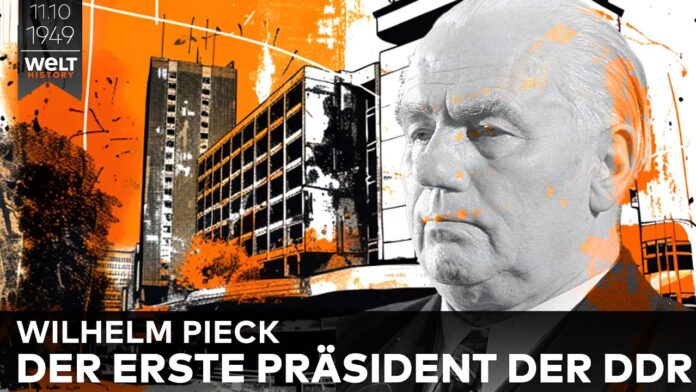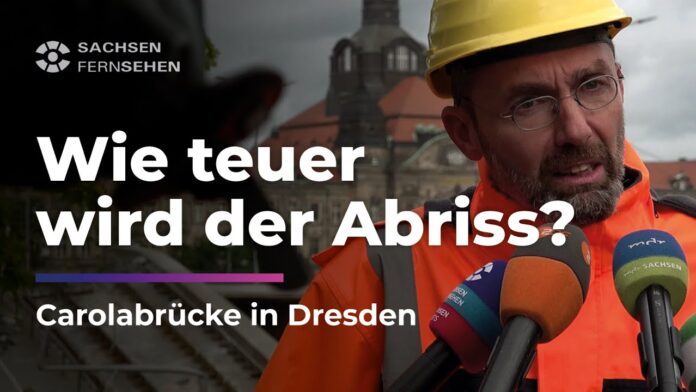Die Bürgerinitiative „Kein Boden fürs EEKICK“ hat sich das Ziel gesetzt, sich kritisch mit der geplanten Entwicklung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiets entlang der A9 und B91 auseinanderzusetzen. Unterstützt von den Städten Teuchern, Weißenfels, Hohenmölsen und Lützen, soll dort ein umfassendes Industriegebiet entstehen. Die Initiative stellt sich nicht prinzipiell gegen Industrie- und Gewerbeansiedlung, sondern fordert vielmehr eine durchdachte, nachhaltige und an die bestehenden Rahmenbedingungen angepasste Planung.
Die Machbarkeitsstudie zum Projekt liegt seit August vor und zeigt die möglichen Auswirkungen und Herausforderungen des EEKICK (Erweitertes Entwicklungsgebiet für kommunale Kooperationen). Doch bei einer näheren Betrachtung wird klar, dass viele wesentliche Fragen unbeantwortet bleiben. So herrscht Unklarheit darüber, wie die benötigten Fachkräfte gewonnen werden sollen, um die geplanten Vorhaben zu realisieren. Der Mangel an qualifiziertem Personal, der auch in anderen Regionen bereits deutlich zu spüren ist, stellt für ein Großprojekt dieser Dimension eine der entscheidenden Fragen dar. Auch die bestehenden Industrie- und Gewerbebrachen in der Region werden nicht ausreichend thematisiert. Viele Flächen bleiben derzeit ungenutzt, und es ist unklar, warum neue Flächen erschlossen werden sollen, ohne zuvor das Potenzial der bestehenden Brachflächen zu prüfen.
Eine weitere wichtige Information, die sich aus der Machbarkeitsstudie ergibt, betrifft das Interesse von Investoren. Es gibt keine festen Zusagen seitens potenzieller Investoren, sondern lediglich vage Anfragen, deren Umfang und Ernsthaftigkeit stark in Frage gestellt werden. Die Dimension des geplanten EEKICK erscheint vor diesem Hintergrund überdimensioniert und wenig gerechtfertigt, wie auch viele Teilnehmer der Informationsveranstaltungen feststellten. Das Fehlen konkreter Investitionszusagen schwächt das Projekt erheblich, da ohne finanzstarke Partner die Umsetzung schwerlich zu realisieren sein dürfte.
Hinzu kommen infrastrukturelle Herausforderungen, wie das Problem der fehlenden Parkplätze für LKWs. Das geplante Industriegebiet zieht automatisch einen hohen Lastverkehr an, doch es fehlen bereits jetzt Konzepte, um die Park- und Ruhemöglichkeiten für LKW-Fahrer sicherzustellen. Die Bürgerinitiative befürchtet, dass sich die umliegenden Dörfer und Ortschaften auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, Lärmbelästigungen und unsachgemäße Parkpraktiken einstellen müssen. Ein unschöner Nebeneffekt, der insbesondere Weißenfels, eine Stadt, die sich als touristischer Standort positioniert und sich mit Städten wie Naumburg oder Freiburg messen möchte, stark beeinträchtigen könnte. Ein riesiges Gewerbegebiet am Stadteingang könnte das Stadtbild erheblich verschlechtern und potenzielle Besucher abschrecken.
Die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie ist zwar ein wichtiger Schritt im Planungsprozess, doch sie stellt lediglich eine Entscheidungsgrundlage dar. Die endgültige Entscheidung liegt bei den Stadträten der beteiligten Kommunen. Diese müssen über die Gründung eines Zweckverbandes abstimmen, der das weitere Vorgehen koordinieren und das Projekt vorantreiben soll. Die Bürgerinitiative setzt alles daran, diese Gründung zu verhindern. Sie appelliert an die Stadträte, die Machbarkeitsstudie kritisch zu prüfen und die langfristigen Auswirkungen auf die Region und die Bevölkerung in ihre Entscheidung einfließen zu lassen. Die Initiative vertritt die Ansicht, dass das EEKICK kein geeignetes Mittel zur Bewältigung des demografischen Wandels ist und auch den Strukturwandel nicht nachhaltig fördern wird.
Der Widerstand der Bürgerinitiative stützt sich auf die Überzeugung, dass ein durchdachterer Ansatz für die Entwicklung der Region notwendig ist. Sie betonen, dass wirtschaftliche Ansiedlung nicht um jeden Preis geschehen sollte. Vielmehr müsse der Fokus auf einer ausgewogenen Planung liegen, die sowohl ökologische als auch soziale Aspekte berücksichtigt. Ein weiteres Argument der Initiative ist, dass eine großflächige Gewerbeansiedlung allein nicht ausreiche, um die strukturellen Probleme der Region zu lösen. Stattdessen sei eine kluge und langfristig angelegte Strategie notwendig, die auch den Erhalt der bestehenden Infrastruktur sowie die Nutzung bereits erschlossener Flächen einbeziehe.
Die Bürgerinitiative „Kein Boden fürs EEKICK“ ruft die Bürger der betroffenen Kommunen dazu auf, sich aktiv in den Entscheidungsprozess einzubringen. Sie bietet mehrere Möglichkeiten, um die Initiative zu unterstützen. Dazu gehört das Unterschreiben von Petitionen, das Spenden für die weitere Arbeit der Initiative sowie die Unterstützung über verschiedene Informationskanäle, die regelmäßig über den aktuellen Stand der Planungen und den Widerstand dagegen informieren.
Insgesamt bleibt die Situation um das geplante Gewerbegebiet an der A9 und B91 weiterhin offen. Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend dafür sein, ob das Projekt tatsächlich umgesetzt wird oder ob die Argumente der Bürgerinitiative Gehör finden und eine andere, nachhaltigere Lösung für die Region gefunden wird. Klar ist: Die Initiative wird den Prozess weiterhin aufmerksam verfolgen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Gründung des Zweckverbandes zu verhindern.
Petition: STOP zum Flächenfraß im BLK an B91/A9 – FÜR sinnvollen Strukturwandel