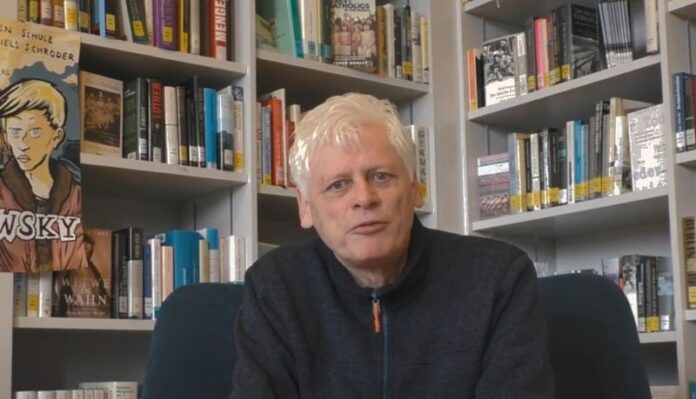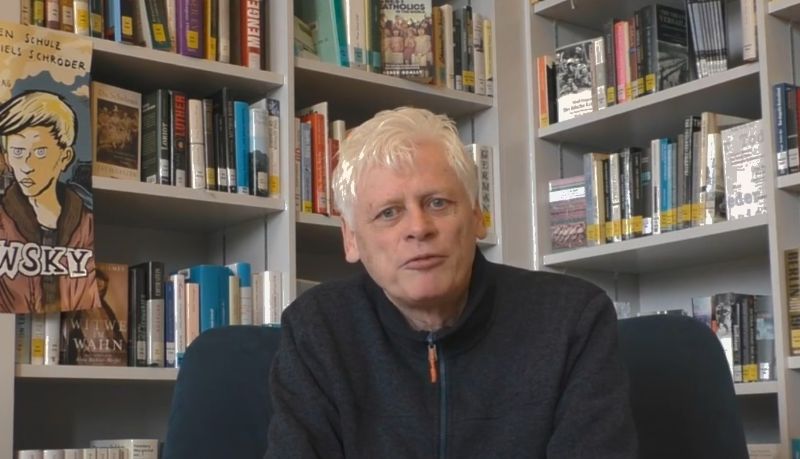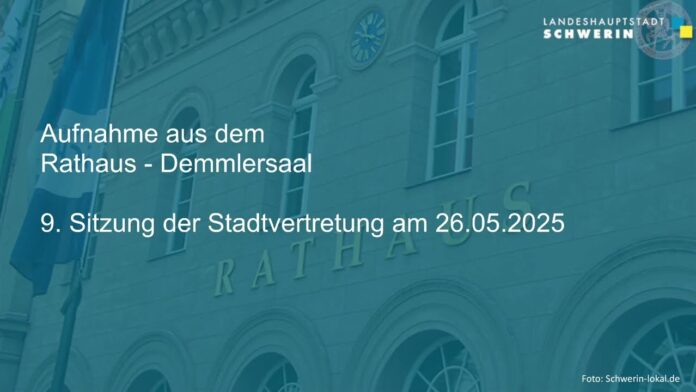Der Pop-Titan Dieter Bohlen, bekannt für seine direkte Art und jahrzehntelange Erfolge im Musikgeschäft, hat in einem aktuellen Interview ungewohnt private Einblicke in seine Gedanken zur wirtschaftlichen und politischen Lage in Deutschland und Europa gegeben. Dabei sparte er nicht mit Kritik und offenbarte seine persönlichen Ängste sowie Strategien zur Krisenbewältigung.
In dem Gespräch mit BENU Solutions, das am 27. Mai 2025 ausgestrahlt wurde, äußerte Bohlen deutliche Bedenken hinsichtlich der finanziellen Zukunft und der Stabilität des Landes. „Die Angst, die habe ich jeden Tag“, gestand der Musikproduzent und bezog dies auf die Sorge, dass das über 45 Jahre erarbeitete Vermögen durch politische Entscheidungen gefährdet werden könnte. Er kritisierte insbesondere die Zinspolitik und die Besteuerung in Deutschland. Die Empfehlung von Politikern wie Olaf Scholz, Geld auf dem Sparbuch anzulegen, sei angesichts fallender Zinsen und fehlender Renditen realitätsfern. „Dieser Staat hat natürlich so aufgepasst, dass es nichts und gar nichts mehr gibt irgendwie, wo du keine Steuern drauf zahlst“, so Bohlen.
Steuerlast und Abwanderungsgedanken
Ein zentrales Thema für Bohlen ist die hohe Steuerlast und die Diskussion um mögliche weitere Steuererhöhungen oder die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer. Er berichtete von einer wachsenden Zahl vermögender Personen und Unternehmer, die Deutschland den Rücken kehren und beispielsweise nach Dubai oder in die Schweiz auswandern, um einer als erdrückend empfundenen Abgabenlast zu entgehen. „Jeder fährt quasi, guckt sich da schon ein Dubai an“, schilderte Bohlen seine Beobachtungen. Er selbst zahle bereits fast 50 Prozent Steuern und frage sich, warum er sich weitere Belastungen gefallen lassen solle. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags sei ein Beispiel für enttäuschte Hoffnungen, da solche Abgaben seiner Meinung nach nie wirklich abgeschafft würden.
Deutschlands Ansehen in der Welt und politische Fehlentscheidungen
Bohlen zeichnete ein düsteres Bild vom internationalen Ansehen Deutschlands. Das einstige Renommee von „Made in Germany“ sei verblasst. „Wenn die Leute wüssten in Deutschland, wie sich das verändert hat, das Bild von Deutschland im Ausland […] die lachen sich alle tot“, meinte er. Er kritisierte die deutsche Außenpolitik der letzten Jahre scharf und verwies auf verschlechterte Beziehungen zu wichtigen Partnern wie Russland, China und den USA. „Mit wem wollen wir denn überhaupt noch Geschäfte machen? Mit Helgoland und Legoland und Kaufland oder was?“, fragte er provokant.
Umgang mit Erfolg und Krisen: Bohlens Ratschläge
Aus seiner langen Karriere im Showgeschäft, in der er viele Aufstiege und Abstürze miterlebt hat, leitete Bohlen auch Ratschläge für den Umgang mit Erfolg und potenziellen Krisen ab. Überschätzung und Hochmut seien die Hauptgründe für das Scheitern vieler Menschen. „Erfolg ist eine Ausnahme und nicht die Regel“, betonte er und riet dazu, finanzielle Mittel in guten Zeiten zusammenzuhalten und nicht davon auszugehen, dass der Erfolg ewig anhalte. Er selbst lebe „in permanenten Worst-Case-Szenarien“ und sei darauf vorbereitet, Deutschland notfalls innerhalb von sechs Stunden verlassen zu können. Sein Fokus habe sich daher auch von der Musikproduktion stärker auf Immobilien, Aktien und andere Investments verlagert, da sich das Musikgeschäft für ihn nicht mehr im gleichen Maße lohne.
Persönliche Strategien: Sport und positives Denken
Als persönliche Strategie, um auch in Krisenzeiten ein positives Mindset zu bewahren, nannte Bohlen vor allem Sport. Eine feste Morgenroutine inklusive Sport helfe ihm, sich gut zu fühlen und den Tag positiv zu beginnen. Zudem riet er dazu, sich von toxischen Einflüssen und Menschen zu befreien.
Das Interview offenbarte einen Dieter Bohlen, der sich abseits der Showbühne intensiv mit wirtschaftlichen und politischen Fragen auseinandersetzt und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um seine Sorgen und seine Kritik an den aktuellen Zuständen in Deutschland geht.

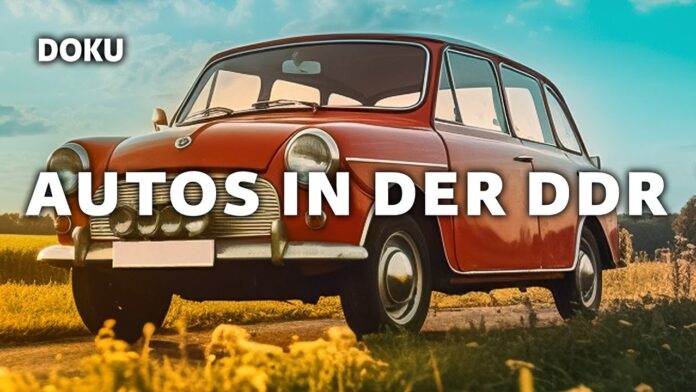

 Opferverbände fordern Entfernung der Statue und planen Verhüllung – Stadt ringt seit Jahrzehnten um Umgang mit dem Monument
Opferverbände fordern Entfernung der Statue und planen Verhüllung – Stadt ringt seit Jahrzehnten um Umgang mit dem Monument