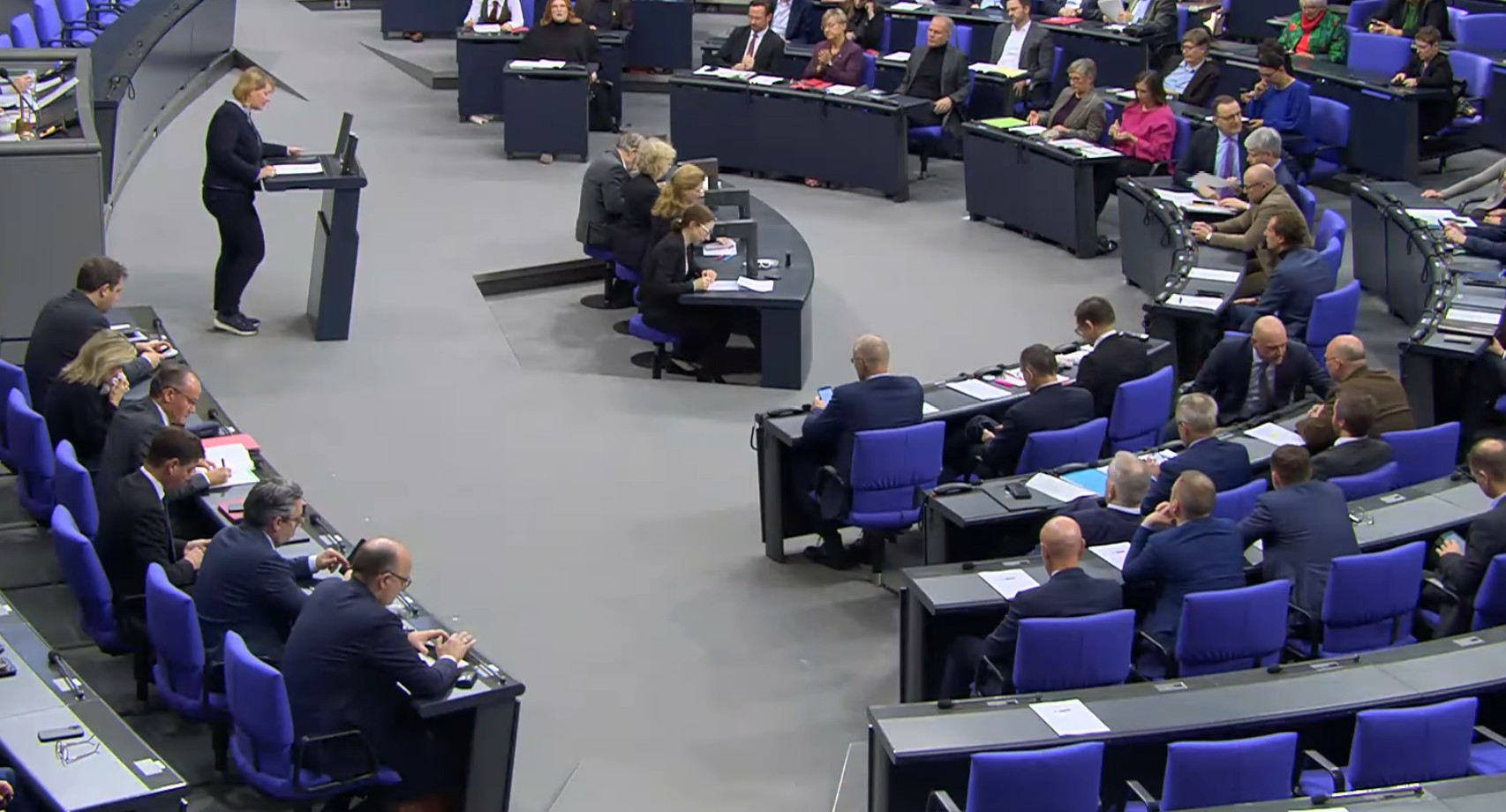 Die Debatte um das Standortfördergesetz im Deutschen Bundestag, die eigentlich technische Finanzfragen und Investitionsanreize klären soll, verwandelt sich schnell in einen grundlegenden Schlagabtausch über Wirtschaftsordnungen. Es ist der 22. Dezember 2025, und während draußen die Weihnachtsmärkte leuchten, wird im Plenarsaal die Vergangenheit beschworen. Kai Gottschalk von der AfD nutzt seine Redezeit nicht nur für Kritik an Steuergesetzen, sondern für einen historischen Vergleich, der tief sitzt. Er spricht von „sozialistischer Lenkung“ und zieht Parallelen zur DDR, die viele im Saal so nicht stehen lassen wollen.
Die Debatte um das Standortfördergesetz im Deutschen Bundestag, die eigentlich technische Finanzfragen und Investitionsanreize klären soll, verwandelt sich schnell in einen grundlegenden Schlagabtausch über Wirtschaftsordnungen. Es ist der 22. Dezember 2025, und während draußen die Weihnachtsmärkte leuchten, wird im Plenarsaal die Vergangenheit beschworen. Kai Gottschalk von der AfD nutzt seine Redezeit nicht nur für Kritik an Steuergesetzen, sondern für einen historischen Vergleich, der tief sitzt. Er spricht von „sozialistischer Lenkung“ und zieht Parallelen zur DDR, die viele im Saal so nicht stehen lassen wollen.
„Eigentlich dachte ich, nach den Erfahrungen in der DDR wären die Zeiten von Marx und Engels vorbei“, ruft Gottschalk ins Mikrofon und wirft der Regierung vor, „echte Sozialisten“ zu sein. Für viele Ostdeutsche, die die Planwirtschaft real erlebt haben, ist dies ein zweischneidiges Schwert. Einerseits resoniert die Warnung vor staatlicher Überregulierung bei jenen, die den Mangel verwaltet haben. Andererseits wirkt der Vergleich der heutigen sozialen Marktwirtschaft mit dem Zwangssystem der SED für viele wie eine Verharmlosung der damaligen Diktatur. Die Rhetorik nutzt das historische Trauma, um gegen moderne Steuerpolitik zu mobilisieren.
Die Reaktion im Parlament lässt nicht lange auf sich warten und offenbart die Bruchlinien im Umgang mit der deutschen Geschichte. Der Vorwurf des „Staatskapitalismus der ganz schlechten Art“ wird laut, und die Begriffe des Klassenkampfes werden ironisch gegen die Ministerin für Arbeit gewendet. Es zeigt sich, wie die DDR-Geschichte auch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung als Folie dient, auf die aktuelle Ängste projiziert werden. Die Regierungskoalition, hier vertreten durch die SPD, weist diese historische Gleichsetzung scharf zurück und betont die Notwendigkeit staatlicher Investitionen für die Zukunftssicherung, statt ideologischer Grabenkämpfe.
Ein weiterer Aspekt der Debatte berührt die ostdeutsche Identität und den Umgang mit nationalen Symbolen auf einer noch persönlicheren Ebene. In einer Kurzintervention wird Gottschalk auf ein Video angesprochen, das ihn beim Singen der ersten Strophe des Deutschlandliedes zeigen soll – ein Symbol, das historisch extrem belastet ist. Die Verteidigung Gottschalks, es handele sich um ein historisches Lied von 1841, prallt auf den Vorwurf, sich mit den dunkelsten Zeiten der Geschichte gemein zu machen. Hier vermischen sich die Debatten über das DDR-Erbe und die NS-Vergangenheit zu einer toxischen Melange, die den sachlichen Diskurs überlagert.
Besonders hellhörig macht der Moment, in dem die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland mit der Flucht von Unternehmen verglichen wird. Gottschalk spricht von einer „Reichsfluchtsteuer“ im Kontext der Wegzugsbesteuerung. Auch wenn er den Begriff später als „Wegzugsbeschleunigungssteuer“ umdeutet, ist die Assoziation gesetzt. Für Menschen, die in der DDR lebten, war das Verlassen des Landes oft lebensgefährlich und politisch unmöglich. Die Gleichsetzung steuerlicher Hürden für Kapital mit den physischen Mauern der Vergangenheit ist ein rhetorisches Mittel, das die historische Realität der DDR-Grenze für tagespolitische Zwecke instrumentalisert.
Die Grünen, vertreten durch Katharina Beck, versuchen, den Fokus wieder auf die Chancen der Transformation zu lenken, doch der Vorwurf der „Öko-Transformation“ als planwirtschaftliches Element bleibt im Raum stehen. Es wird deutlich, dass die Transformation der ostdeutschen Wirtschaft nach 1990 Narben hinterlassen hat, die bei jedem staatlichen Eingriff wieder schmerzen. Wenn heute über Subventionen und Strukturwandel gesprochen wird, schwingt im Osten immer die Erfahrung der Treuhand und der Deindustrialisierung mit. Die Angst vor einem erneuten Scheitern, diesmal unter grünen Vorzeichen, wird von der Opposition gezielt bewirtschaftet.
Der Diskurs zeigt, dass die „Vollendung der Einheit“ in den Köpfen noch lange nicht abgeschlossen ist. Wenn Begriffe wie „Sozialismus“ und „Planwirtschaft“ fallen, geht es selten um eine präzise historische Analyse, sondern um emotionale Trigger. Die Debatte um das Standortfördergesetz wird so zu einer Stellvertreterdiskussion über die Deutungshoheit der ostdeutschen Geschichte. Wer darf definieren, was Freiheit ist und was Zwang? Die unterschiedlichen Lebenserfahrungen in Ost und West prallen hier aufeinander, oft unvermittelt und ohne die nötige Sensibilität für die Nuancen der jeweils anderen Seite.
Am Ende der Debatte steht ein Gesetz, das beschlossen wird, aber auch ein Nachgeschmack der Zerrissenheit. Die parlamentarische Auseinandersetzung hat gezeigt, dass die DDR nicht nur Geschichte ist, sondern ein aktiver Bestandteil der politischen Auseinandersetzung der Gegenwart. Die Warnung vor „roten“ oder „grünen“ Experimenten verfängt dort am stärksten, wo die Erinnerung an staatliche Bevormundung noch frisch ist. Doch die bloße Instrumentalisierung dieser Erinnerung löst die Probleme der Zukunft – Investitionen, Digitalisierung, Infrastruktur – keinen einzigen Schritt.