 Der scheidende Ministerpräsident zieht kurz vor dem Ende seiner Amtszeit eine Bilanz zwischen zwei politischen Systemen und den prägenden Brüchen der Nachwendezeit.
Der scheidende Ministerpräsident zieht kurz vor dem Ende seiner Amtszeit eine Bilanz zwischen zwei politischen Systemen und den prägenden Brüchen der Nachwendezeit.
In der Magdeburger Staatskanzlei bereitet sich Reiner Haseloff auf seinen Abschied vor. Fast 15 Jahre lang hat der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands das Land Sachsen-Anhalt geführt, doch im kommenden Jahr soll Schluss sein. Es ist ein Zeitpunkt, der nicht nur das Ende einer politischen Karriere markiert, sondern auch Anlass für eine biografische Zwischenbilanz gibt. Haseloff, der als ostdeutscher Katholik geprägt wurde, verweist in diesen Tagen oft auf die Zweiteilung seines Lebens. Die erste Hälfte verbrachte er in einer Diktatur, die zweite in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik. Diese Erfahrung der Systemgrenze ist für ihn kein bloßes historisches Faktum, sondern der Schlüssel zum Verständnis der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung in Ostdeutschland.
Wenn Haseloff auf die Jahre nach der Wiedervereinigung zurückblickt, wählt er keine verklärenden Worte. Die ersten zehn Jahre waren „alles andere als ein Zuckerlecken“, sagt er. Er spricht von „Transformationsbrüchen“, die an der Substanz der Bevölkerung gezehrt haben. Diese Wortwahl ist entscheidend, um die politische Gegenwart im Osten zu begreifen. Die massiven Umbrüche, der Verlust von Arbeitsplätzen und die Entwertung von Biografien wirken bis heute nach. Es ist ein kollektives Gedächtnis, das sensibel auf jede Form von neuer Instabilität reagiert. Der Wunsch, dass sich die existenziellen Unsicherheiten der Nachwendezeit nicht wiederholen, ist laut Haseloff eine treibende Kraft in der heutigen Wählerschaft.
Diese tiefsitzende Sorge um den eigenen Status und die wirtschaftliche Sicherheit bildet den Resonanzboden für die aktuellen Wahlergebnisse. In Sachsen-Anhalt sieht sich die CDU mit Umfragewerten konfrontiert, die die AfD bei 40 Prozent verorten. Haseloff analysiert dies nüchtern, ohne die Wähler pauschal zu verurteilen, aber auch ohne die Dramatik zu beschönigen. Er warnt davor, dieses Phänomen lediglich als Frustwahl abzutun. Vielmehr sieht er darin eine Verfestigung, bei der knapp die Hälfte der Bevölkerung die Inhalte der Partei als sinnvolle Alternative betrachtet. Die politische Mitte, so seine Beobachtung, hat es zunehmend schwerer, diese Menschen zurückzugewinnen, je länger die versprochenen Ergebnisse der Regierungskoalitionen ausbleiben.
Die Gefahr sieht der Ministerpräsident nicht nur in prozentualen Verschiebungen, sondern in einer fundamentalen Änderung der Staatsräson. Eine Regierungsbeteiligung der AfD würde den Zugriff auf relevante gesellschaftliche Bereiche bedeuten – von der Polizei über die Justiz bis hin zum Schulunterricht. Haseloff skizziert ein Szenario, in dem aus dem Leitbild eines weltoffenen Landes ein verengtes „Deutsch denken“ würde. Er zieht dabei historische Parallelen und mahnt, genau hinzuschauen, welche Ideologien hinter den aktuellen Parolen stehen. Für jemanden, der die DDR erlebt hat, ist der Rückfall in unfreie oder nationalistisch verengte Strukturen keine theoretische Dystopie, sondern eine reale Gefahr, die es durch historische Bildung zu erkennen gilt.
Auch beim Thema Migration argumentiert Haseloff weniger ideologisch als strukturell. Er beschreibt die Situation in den Kommunen als eine Ressourcenfrage. Wenn finanzschwache Landkreise kaum noch Handlungsspielräume in der Selbstverwaltung haben, weil die Bewältigung der Migration die Haushalte bindet, erzeugt dies politischen Druck. Seine Forderung nach einer Rückkehr zum Prinzip des Förderns und Forderns sowie nach einer stärkeren Steuerung orientiert sich an pragmatischen Vorbildern wie Dänemark. Es ist der Versuch, durch staatliche Handlungsfähigkeit das Vertrauen in die Institutionen zu stabilisieren und den Rändern das Wasser abzugraben.
Am Ende seiner Amtszeit bleibt der Blick auf das, was nach der Politik kommt. Haseloff spricht von den Tausenden Büchern, die sich zu Hause stapeln und die er nun ordnen und lesen möchte. Es ist das Bild eines Mannes, der sich auf eine private Intellektualität zurückzieht, die während der Regierungsjahre oft zu kurz kam. Er will im Land unterwegs sein, sich um die Enkel kümmern, aber ein politischer Mensch bleiben. Der Übergang vom aktiven Gestalter zum beobachtenden Bürger scheint für ihn ein logischer Schritt zu sein, der die biografische Klammer eines Lebens zwischen zwei deutschen Staaten schließt.


 Der Schauspieler beschreibt den untergegangenen Staat als ein Atlantis und erklärt, warum eine spezifische ostdeutsche Renitenz bis heute in den politischen Debatten nachhallt.
Der Schauspieler beschreibt den untergegangenen Staat als ein Atlantis und erklärt, warum eine spezifische ostdeutsche Renitenz bis heute in den politischen Debatten nachhallt.
 Der tatsächliche Status eines Bürgers im Sozialismus hing weit weniger von seinem Bildungsgrad ab, als von seinem Zugang zu knappen Waren und westlichen Devisen.
Der tatsächliche Status eines Bürgers im Sozialismus hing weit weniger von seinem Bildungsgrad ab, als von seinem Zugang zu knappen Waren und westlichen Devisen.
 Hinter den Parolen der offiziellen Waffenbrüderschaft verbarg sich ein komplexer Alltag zwischen Isolation, wirtschaftlicher Abhängigkeit und pragmatischen Begegnungen.
Hinter den Parolen der offiziellen Waffenbrüderschaft verbarg sich ein komplexer Alltag zwischen Isolation, wirtschaftlicher Abhängigkeit und pragmatischen Begegnungen.
 Ende 1990 forderte Arbeitsminister Norbert Blüm einen radikalen Markteingriff, um das ostdeutsche Gesundheitswesen vor dem finanziellen Kollaps zu bewahren.
Ende 1990 forderte Arbeitsminister Norbert Blüm einen radikalen Markteingriff, um das ostdeutsche Gesundheitswesen vor dem finanziellen Kollaps zu bewahren.
 Drei Autorinnen und ein Soziologe haben die Stimmung zwischen Erzgebirge und Uckermark erkundet und zeichnen das Bild einer Gesellschaft im klimatischen Wandel.
Drei Autorinnen und ein Soziologe haben die Stimmung zwischen Erzgebirge und Uckermark erkundet und zeichnen das Bild einer Gesellschaft im klimatischen Wandel.
 Zwischen staatlicher Zersetzung und kirchlichem Schutzraum entwickelte sich eine Subkultur, die das System allein durch ihre Existenz in Frage stellte.
Zwischen staatlicher Zersetzung und kirchlichem Schutzraum entwickelte sich eine Subkultur, die das System allein durch ihre Existenz in Frage stellte.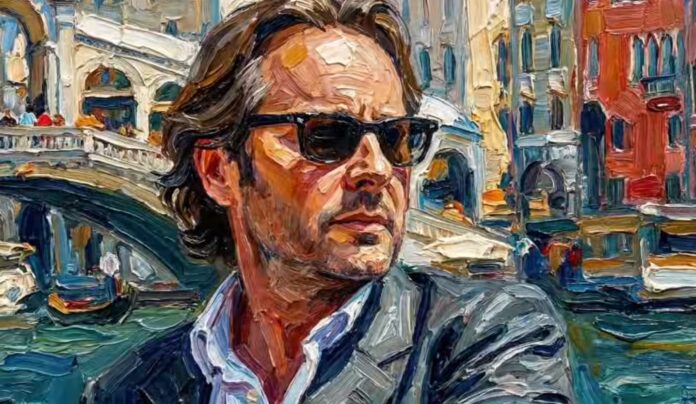
 Wer verstehen will, warum dieser Schauspieler in seinen Rollen oft nichts sagen musste, um alles auszudrücken, muss in seine Akte aus dem Jahr 1961 blicken.
Wer verstehen will, warum dieser Schauspieler in seinen Rollen oft nichts sagen musste, um alles auszudrücken, muss in seine Akte aus dem Jahr 1961 blicken.
 Für sowjetische Offiziere galt die Versetzung in die DDR nicht als Belastung, sondern als der prestigeträchtigste Posten, den die Rote Armee zu vergeben hatte.
Für sowjetische Offiziere galt die Versetzung in die DDR nicht als Belastung, sondern als der prestigeträchtigste Posten, den die Rote Armee zu vergeben hatte.
 Ein genauer Vergleich zweier Veröffentlichungen zeigt exemplarisch, wie differenzierte gesellschaftliche Analysen im politischen Diskurs verengt werden.
Ein genauer Vergleich zweier Veröffentlichungen zeigt exemplarisch, wie differenzierte gesellschaftliche Analysen im politischen Diskurs verengt werden.