
Es gibt Beiträge, die sind so alt, dass sie beinahe schon ins Geschichtshistorische gehören – lange vor der Wende, aber auch viele Jahre danach. Mit Jenapolis habe ich eigentlich immer versucht, tagesaktuelle Themen aufzugreifen, Dinge, die die Menschen unmittelbar trafen, bewegten, aufrüttelten. Das wird es auch weiterhin geben, immer dann, wenn es notwendig ist. Aber man muss nicht mehr jede Kuh durchs digitale Dorf treiben.
Die frühere Notwendigkeit, Bürgerinnen und Bürger über soziale Medien zuverlässig zu informieren, darf man nüchtern betrachtet ohnehin als weitgehend erledigt ansehen. Informationskanäle gibt es heute mehr als genug. Was fehlt, ist nicht Information, sondern Einordnung, Erinnerung, Zusammenhang. Vielleicht ist es gerade deshalb in diesen Zeiten wichtiger, darüber nachzudenken – oder auch darüber zu berichten –, was eigentlich alles einmal war. Dinge, die man heute schnell als „uralt“ abtut. Und doch ist es genau dieses „Uralte“, nach dem viele gerade wieder rufen, wenn sie sagen: Ich will es wieder so haben wie früher.
Dann sollte man auch zeigen dürfen, was dieses „früher“ konkret bedeutete. Am Beispiel von Jena etwa: Was hier einmal da war. Was gewachsen ist. Und was heute nicht mehr existiert. Was verloren ging – durch Corona, durch fehlende Kommunikation, durch Unsensibilitäten, durch Müdigkeit, vielleicht auch durch Bequemlichkeit. Warum sollen wir uns immer nur an die jeweils aktuelle Verschiebungsebene anpassen? Warum nicht auch einmal sichtbar machen, wie engagiert und dynamisch dieses Stadtmilieu einmal gewesen ist – mit seiner Zivilgesellschaft, mit seiner Diskussionskultur, mit seinem selbstverständlichen bürgerschaftlichen Engagement?
Das war eine Zeit, die auch ich als ausgesprochen spannend erlebt habe. Eine Zeit, in der ich mich selbst gerne eingebracht habe, in der man das Gefühl hatte, dass Beteiligung noch Wirkung entfalten kann. Heute, mit zunehmendem Alter, komme ich nicht mehr automatisch auf die Idee, mich in gleicher Weise zu engagieren. Und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht mehr diese breite, sichtbare Bereitschaft, sich für die wirklichen Themen der Stadt einzusetzen. Natürlich liegt das, wie so vieles, im Auge des Betrachters. Aber wer hier liest, muss für diesen Moment mit meinem Blick Vorlieb nehmen.
In Zeiten des allgegenwärtigen Meckerns und der permanenten Empörung kann es vielleicht sogar heilsam sein, nicht noch ein weiteres aktuelles Problem nach dem anderen zu sezieren, sondern gelegentlich zu zeigen, was einmal möglich war. Nicht aus nostalgischer Verklärung, sondern als ernüchternder, manchmal auch ermutigender Vergleich. Daran kann man sich Beispiele nehmen – wie man es vielleicht wieder machen könnte. Vielleicht war es damals besser. Vielleicht war es schlechter. Vielleicht war es schlicht anders. Aber anders heißt nicht automatisch irrelevant.
Genau darin liegt für mich eine neue, alte journalistische Aufgabe: Das Vergangene nicht als sentimentales Archiv zu behandeln, sondern als Erfahrungsraum. Als Spiegel. Als Angebot zum Nachdenken. Geschichte nicht als Staubschicht, sondern als Werkstatt. Als Fundus für Ideen, für Brüche, für verpasste Chancen – und für das, was schon einmal funktioniert hat.
Ich will also nicht aufhören, über das Aktuelle zu schreiben. Aber ich will mir die Freiheit nehmen, auch wieder stärker über das zu berichten, was viele vorschnell als „uralt“ abtun. Gerade weil dieses „Uralte“ heute wieder so überraschend modern erscheint. Und gerade weil man aus ihm mehr lernen kann, als aus manchem tagesaktuellen Aufreger.
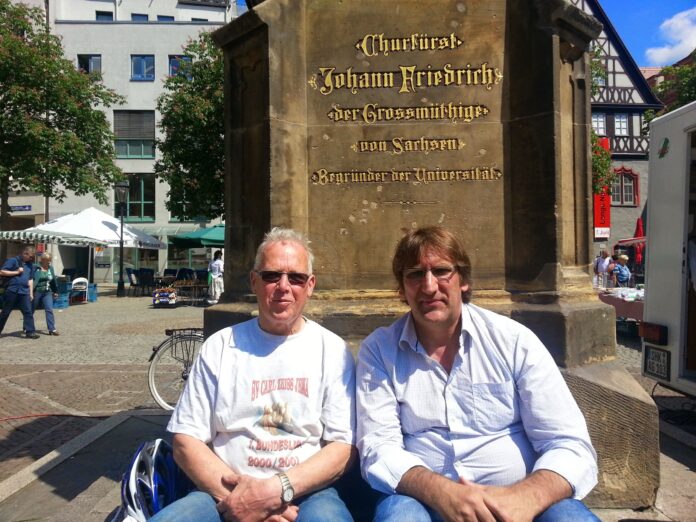

 Jena im August 2011. Die Empörung in Jena ist groß. Was als polizeiliche Ermittlung der sächsischen Behörden begann, hat sich innerhalb weniger Stunden zu einem Politikum entwickelt, das weit über die Stadtgrenzen hinaus Wellen schlägt. Über 600 Menschen versammelten sich, um ein deutliches Zeichen der Solidarität für den Jenaer Stadtjugendpfarrer Lothar König zu setzen, dessen Wohn- und Diensträume zuvor durchsucht worden waren.
Jena im August 2011. Die Empörung in Jena ist groß. Was als polizeiliche Ermittlung der sächsischen Behörden begann, hat sich innerhalb weniger Stunden zu einem Politikum entwickelt, das weit über die Stadtgrenzen hinaus Wellen schlägt. Über 600 Menschen versammelten sich, um ein deutliches Zeichen der Solidarität für den Jenaer Stadtjugendpfarrer Lothar König zu setzen, dessen Wohn- und Diensträume zuvor durchsucht worden waren.
 Es ist eine Geschichte von geopolitischem Kalkül und persönlichem Abenteuer. Tausende DDR-Arbeiter schufen in der Sowjetunion ein Jahrhundertbauwerk, dessen stählerne Adern bis heute den Kontinent versorgen.
Es ist eine Geschichte von geopolitischem Kalkül und persönlichem Abenteuer. Tausende DDR-Arbeiter schufen in der Sowjetunion ein Jahrhundertbauwerk, dessen stählerne Adern bis heute den Kontinent versorgen.
 Fast ein halbes Jahrhundert lang war Ostdeutschland nicht nur ein Staat, sondern eine riesige Kaserne. Eine bemerkenswerte Dokumentation öffnet nun die Tore der „Verbotenen Stadt“ Wünsdorf und wirft ein Licht auf den Alltag, die Ängste und das stille Ende der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD).
Fast ein halbes Jahrhundert lang war Ostdeutschland nicht nur ein Staat, sondern eine riesige Kaserne. Eine bemerkenswerte Dokumentation öffnet nun die Tore der „Verbotenen Stadt“ Wünsdorf und wirft ein Licht auf den Alltag, die Ängste und das stille Ende der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD).
 Erfurt – Es ist ein straffes Programm, das dem Thüringer Landtag in den letzten Wochen des Jahres 2025 bevorsteht. Andreas Bühl, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, skizzierte auf der Landespressekonferenz am Dienstag nicht nur einen parlamentarischen Marathon mit drei Plenarsitzungen, sondern richtete auch deutliche Worte an die politische Konkurrenz – sowohl an die Verhandlungspartner der Linken als auch an die AfD.
Erfurt – Es ist ein straffes Programm, das dem Thüringer Landtag in den letzten Wochen des Jahres 2025 bevorsteht. Andreas Bühl, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, skizzierte auf der Landespressekonferenz am Dienstag nicht nur einen parlamentarischen Marathon mit drei Plenarsitzungen, sondern richtete auch deutliche Worte an die politische Konkurrenz – sowohl an die Verhandlungspartner der Linken als auch an die AfD.
 Erfurt. In der Landespressekonferenz am Dienstag, dem 2. Dezember 2025, hat der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke einen harten Konfrontationskurs sowohl gegen die Thüringer Landesregierung als auch gegen die Justiz angekündigt. Neben der kategorischen Ablehnung des aktuellen Haushaltsentwurfs standen vor allem ein neues Urteil zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst und geopolitische Grundsatzfragen im Fokus.
Erfurt. In der Landespressekonferenz am Dienstag, dem 2. Dezember 2025, hat der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke einen harten Konfrontationskurs sowohl gegen die Thüringer Landesregierung als auch gegen die Justiz angekündigt. Neben der kategorischen Ablehnung des aktuellen Haushaltsentwurfs standen vor allem ein neues Urteil zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst und geopolitische Grundsatzfragen im Fokus.
 Wir leisten, wir funktionieren, wir passen uns an. Doch oft ist der Preis dafür unsere seelische Gesundheit. Der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz diagnostiziert einer ganzen Gesellschaft einen „Gefühlsstau“. Seine These: Wer nicht liebt, muss leisten – und wer sich selbst nicht spürt, macht andere krank.
Wir leisten, wir funktionieren, wir passen uns an. Doch oft ist der Preis dafür unsere seelische Gesundheit. Der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz diagnostiziert einer ganzen Gesellschaft einen „Gefühlsstau“. Seine These: Wer nicht liebt, muss leisten – und wer sich selbst nicht spürt, macht andere krank.
 Ich bin 1967 in Burg bei Magdeburg geboren. Ossi – dieses Wort ist für mich keine Zuschreibung, sondern Biografie. Kindheit in der DDR, Schule, Jugend, ein festes Koordinatensystem aus Gewissheiten, Regeln, Grenzen. Ich habe das alles erlebt, ohne es einordnen zu können, weil man als Kind nicht einordnet. Man lebt. Man nimmt hin. Man lernt, sich zu orientieren in dem, was da ist. Erst viel später versteht man, was einen eigentlich geprägt hat.
Ich bin 1967 in Burg bei Magdeburg geboren. Ossi – dieses Wort ist für mich keine Zuschreibung, sondern Biografie. Kindheit in der DDR, Schule, Jugend, ein festes Koordinatensystem aus Gewissheiten, Regeln, Grenzen. Ich habe das alles erlebt, ohne es einordnen zu können, weil man als Kind nicht einordnet. Man lebt. Man nimmt hin. Man lernt, sich zu orientieren in dem, was da ist. Erst viel später versteht man, was einen eigentlich geprägt hat.
 Die Deutsche Demokratische Republik verfügte über eines der dichtesten Netze an Kinderbetreuungseinrichtungen. Bis zum Jahr 1989 existierten über 7.700 Einrichtungen, die rund 80 Prozent der Kinder unter drei Jahren betreuten. Diese hohe Versorgungsdichte war das Ergebnis einer gezielten Sozialpolitik. Eine Analyse der Psychoanalytikerin Agathe Israel untersucht die Hintergründe dieser staatlichen Betreuung, die pädagogische Praxis und die Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder.
Die Deutsche Demokratische Republik verfügte über eines der dichtesten Netze an Kinderbetreuungseinrichtungen. Bis zum Jahr 1989 existierten über 7.700 Einrichtungen, die rund 80 Prozent der Kinder unter drei Jahren betreuten. Diese hohe Versorgungsdichte war das Ergebnis einer gezielten Sozialpolitik. Eine Analyse der Psychoanalytikerin Agathe Israel untersucht die Hintergründe dieser staatlichen Betreuung, die pädagogische Praxis und die Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder.
 Eine Kolumne über die schwierige Kunst, die eigene Vergangenheit zu lieben, ohne die Umstände zu verklären.
Eine Kolumne über die schwierige Kunst, die eigene Vergangenheit zu lieben, ohne die Umstände zu verklären.