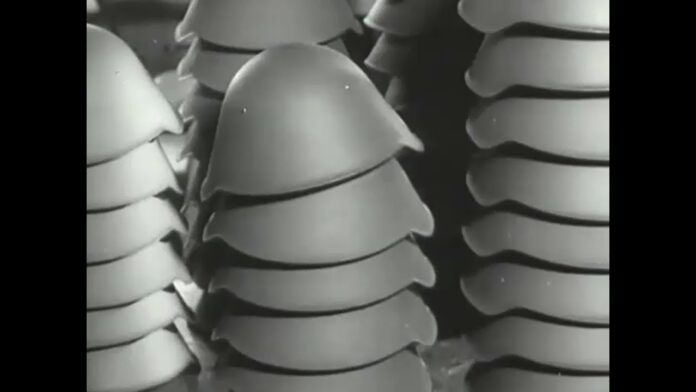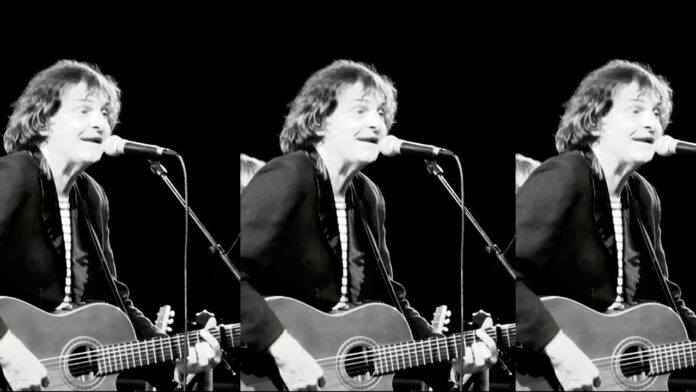Von der verdeckten Spezialeinheit zum lebendigen Andenken – wie die Fallschirmjäger der DDR Vergangenheit und Gegenwart verbinden.
Magdeburg, Frühjahr 2009. Eine Antonow 28 zieht ihre Bahn am Himmel, darunter: Männer, die einst zu den geheimsten Elitesoldaten der DDR gehörten. Heute springen sie wieder – aus Freude, aus Nostalgie, aus einem Gefühl von Zusammengehörigkeit. Renato Pitsch und seine Kameraden inszenieren ihre Vergangenheit für das Publikum, doch ihre Geschichte ist mehr als ein Spektakel. Sie erzählt von Idealismus, Disziplin – und dem Missbrauch militärischer Stärke durch ein untergehendes Regime.
Fallschirmjäger – ein Mythos in Uniform.
Als „Leistungssportler in Uniform“ beschrieben, wurden DDR-Fallschirmjäger ab den 1960er Jahren zu einer militärischen Eliteeinheit aufgebaut. Auf der Insel Rügen, im Schatten der monumentalen NS-Bauten von Prora, begann ihre geheime Ausbildung: Nahkampf, Fallschirmspringen, Bergsteigen, Skifahren – ein Programm, das kaum ein anderer Soldat der DDR absolvierte.
Doch trotz all ihrer Tarnung ließ sich die Existenz der Einheit nie ganz verbergen. Spätestens als SED-Chef Erich Honecker 1972 dem Truppenteil einen offiziellen Besuch abstattete, war der Schleier des Geheimnisses gelüftet. Öffentlich aber blieb ihr Können weiterhin tabu – der politische Charakter der Einheit stand im Vordergrund: Parteitreue und „sozialistische Persönlichkeitsbildung“ waren ebenso Pflicht wie körperliche Höchstleistung.
Kämpfer gegen das eigene Volk.
1989 – die DDR steht am Rand des Zusammenbruchs. Der Kalte Krieg war nicht heiß geworden, doch die größte Herausforderung für die Fallschirmjäger sollte nicht der NATO-Gegner sein, sondern das eigene Volk. Als die Proteste in Leipzig anschwollen, erhielten sie als erste Einheit den „Fechtsalarm“. „Genossen, die Konterrevolution ist im Anmarsch“ – ein Satz, der dem ehemaligen Gefreiten Matthias Schauch bis heute im Gedächtnis geblieben ist.
Es blieb beim Alarm – die Geschichte entschied sich gegen den Einsatz von Gewalt. Doch der Schock, gegen das eigene Volk antreten zu sollen, ließ viele nicht los. Der Mythos der Elite bekam Risse.
Einsätze im Stillen.
In der Öffentlichkeit trat die Truppe selten auf – wenn überhaupt, dann als Katastrophenhelfer. Im Winter 1978 etwa: Rügen versank unter Schneemassen. Die Fallschirmjäger, mit Skiern unterwegs, versorgten eingeschlossene Bauernhöfe mit Lebensmitteln. Ein seltenes Beispiel dafür, wie ihre Fähigkeiten für zivile Zwecke eingesetzt wurden – und ein Moment echter Anerkennung durch die Bevölkerung.
Leben nach dem Dienst.
Nach der Entlassung wurden viele der Soldaten umworben – vom Ministerium für Staatssicherheit, von der Polizei oder Transportpolizei. Ihre Ausbildung war gefragt, ihr Schweigen ebenso. Doch auch Jahrzehnte später leben viele noch in der Vergangenheit: In Sprüngen, Märschen, Kameradschaftsabenden. Die Schattenseiten der Armee – Drill, politische Indoktrination, psychische Belastung – rücken oft in den Hintergrund. „Man vergisst ja eigentlich die schlechten Sachen“, sagt Renato Pitsch. „Man erinnert sich nur an die guten.“
Zwischen Vergangenheit und Selbstvergewisserung.
Heute pflegen ehemalige DDR-Fallschirmjäger ihre Geschichte als Traditionsgemeinschaft. Ihre Aktivitäten sind Ausdruck einer Identität, die tief mit einem untergegangenen Staat verwoben ist. Zwischen sportlicher Herausforderung und nostalgischer Verklärung steht dabei stets die Frage im Raum: Was bleibt vom Mythos, wenn die Uniform gefallen ist?