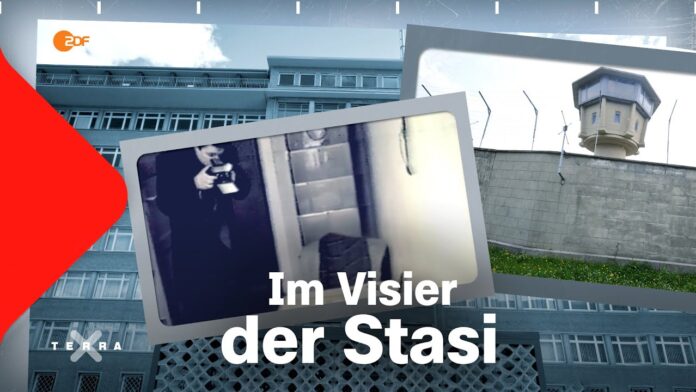Nachfolgend eine kurze Analyse im Audioformat:
Politik in Sachsen: Begegnung der Gegensätze? Kretschmer und Wagenknecht im Dialog über gescheiterte Koalitionen, AfD-Wähler und den Krieg
Dresden – Es war eine Begegnung, die von den Moderatoren als „ungewöhnlich“ und eine „Begegnung der anderen Art“ bezeichnet wurde. Im Rahmen der Reihe „Politik in Sachsen“ trafen in Dresden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Sahra Wagenknecht (Bundesvorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht, BSW) aufeinander, um über aktuelle politische Fragen zu diskutieren – von landespolitischen Bündnissen bis hin zu Krieg und Frieden auf internationaler Bühne. Das Format, eine gemeinsame Initiative der sächsischen Zeitung und Leipziger Volkszeitung, zielte darauf ab, Politik „erlebbar zu machen“ und den Diskurs unterschiedlicher Meinungen abzubilden, unabhängig von anstehenden Wahlen.
Michael Kretschmer beschrieb die bisher einzige persönliche Begegnung mit Frau Wagenknecht als gut, weil sie sich „sehr hart unterhalten“, unterschiedliche Positionen gehabt und trotzdem darüber reden und sich austauschen konnten, ohne „anzugiften“. Sahra Wagenknecht schätzte an Herrn Kretschmer ironisch, dass er sich „Herr Merz zumindest manchmal über ihn geärgert hat“.
Ein zentrales Thema zu Beginn des Abends war das Scheitern der möglichen Koalition aus CDU, SPD und BSW in Sachsen, scherzhaft als „Brombeerkolotion“ bezeichnet, die in einem „Obstsalat ohne Brombeere“ endete.
Das gescheiterte Bündnis: Fehlender Wille zur Veränderung?
Aus Sicht von Sahra Wagenknecht war das Scheitern auf den fehlenden Willen zur Veränderung seitens CDU und SPD zurückzuführen. Sie betonte, dass das BSW eine „ganz junge Partei“ sei, die für bestimmte Inhalte gewählt wurde, darunter Frieden, wirtschaftliche Vernunft, eine andere Energiepolitik, soziale Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit. Diese Inhalte müsse eine Partei, die in eine Regierung eintritt, ernst nehmen, um die Wähler nicht zu „gnadenlos enttäuschen“ und dadurch zu verlieren. Während der Sondierungsgespräche habe man das Gefühl gehabt, dass SPD und CDU ihre bisherige Politik als „toll“ empfänden und das BSW lediglich „mitmachen“ dürfe. Das BSW sei jedoch nicht für ein „Weiter so“ gewählt worden, sondern für Veränderungen. Es habe keine Bereitschaft zur Bewegung gegeben bei Kernthemen wie der Haltung zu Krieg und Frieden, Migration, sozialen Fragen wie einem kostenlosen Mittagessen oder auch der Innenpolitik, etwa dem Umgang mit unterschiedlichen Meinungen. Wagenknecht berichtete, dass ihre Verhandlungsführer „gegen Wende gelaufen“ seien und sie daraufhin entschieden habe, nicht in eine Koalition einzutreten, in der die Wähler enttäuscht würden. Sie stellte klar, dass sie nicht persönlich am Verhandlungstisch saß, aber man sich im BSW „eng konsultiert und abgestimmt“ habe, um die „Schmerzgrenzen“ zu definieren.
Michael Kretschmer bestätigte, dass er im Wahlkampf eine Präferenz für ein Bündnis mit SPD und BSW gegenüber den Grünen erkennen ließ, weil er gemerkt habe, dass die Grünen zumindest zu dem Zeitpunkt „nicht mehr den Wunsch gehabt zu verstehen was die Bevölkerung will und sich selbst auch ein bisschen dem anzupassen“. Er beschrieb das Scheitern als „schade“ und „verstehe es eigentlich auch nicht ganz“, da er glaube, die Dinge „wären alle noch einbar gewesen“, auch beim Thema Krieg und Frieden. Er konstatierte, dass an einem gewissen Punkt die BSW-Kollegen „aufgestanden“ und den Raum verlassen hätten. Trotzdem sei „sehr viel Vertrauen sehr viel Gemeinsames entstanden“ in dieser Zeit, und er sei den BSW-Kollegen dankbar, da sie ihren „eigenen Geist“ und ihre „eigene Vorstellung“ hätten, aber „Sachsen“ seien und „etwas für Sachsen bewegen“ wollten. Er hob den Vorschlag eines Konsultationsmechanismus für die jetzige Minderheitsregierung hervor, der zeige, wer wirklich mitgestalten wolle (BSW, Linke, Grüne prinzipiell bereit) und wer nicht (AfD).
Landespolitik und BSW-Herausforderungen
Sahra Wagenknecht räumte ein, dass sie Landespolitik anfangs als nicht ganz zu ihren Zielen passend empfand, aufgrund des als „eng“ beschriebenen finanziellen Korsetts und fehlendem Gestaltungsspielraum. Sie stellte jedoch klar, dass sie Landespolitik nicht als „profan“ betrachtet, sondern dass Möglichkeiten existieren, wenn die Partner mitziehen. Sie nannte Beispiele für Gestaltungsspielräume außerhalb des Geldes, wie die Bildungspolitik (Inhalte, Umgang mit digitaler vs. analoger Bildung, Handyverbot an Schulen) und die Innenpolitik (Umgang mit unterschiedlichen Meinungen, Sorge vor „radikalem Erlass“ und Prozesse wegen „Politikerbeleidigung“). Diese Dinge seien „eine Frage des Willens“. Sie betonte, dass eine junge Partei wie das BSW es sich nicht leisten könne, in einer Regierung die Wähler zu enttäuschen, da sie sonst Stimmen verliere.
Angesprochen auf das Abschneiden des BSW bei den Bundestagswahlen und die Frage, ob die Partei enttäuscht habe, führte Wagenknecht dies teilweise auf die Regierungsbeteiligungen (speziell in Thüringen) zurück, wo es nicht ausreichend gelungen sei, das wofür man gewählt wurde, umzusetzen. Sie nannte auch eigene Fehler und interne Probleme beim Parteiaufbau (anfängliche Begrenzung der Mitgliederzahl, die Menschen enttäuschte) sowie die vorgezogene Bundestagswahl als „riesiges Problem“ aufgrund fehlender Zeit, Finanzmittel und Organisation. Sie beklagte Schwierigkeiten bei der Buchung mobiler Großflächen im Wahlkampf, da junge Parteien behördliche Genehmigungen dafür schwer erhielten. Trotz dieser Hürden bewertete sie das Ergebnis von faktisch fast 5% nicht als schlecht für eine neue Partei. Sie äußerte zudem den Verdacht auf „extreme Unregelmäßigkeiten im Promillebereich“ bei der Auszählung, die das BSW die 5%-Hürde gekostet haben könnten, und kündigte eine Wahlprüfungsbeschwerde an.
Zum Erfolg der Linkspartei bei der Bundestagswahl sagte Wagenknecht, sie habe nichts dagegen, wenn diese auf Themen (Mietendeckel, soziale Frage) setze, die sie für richtig halte. Sie kritisierte jedoch die Glaubwürdigkeit der Linken, insbesondere bei der Friedensfrage, da sie das größte Aufrüstungspaket durchgewunken hätten. Sie sieht das Profil der Linken eher bei enttäuschten Grünen- und SPD-Wählern und nicht in direkter Konkurrenz zum BSW, da die Linke bei Migration und Klimapolitik (radikale erneuerbare Energien) weit entfernt sei von den BSW-Positionen.
Umgang mit AfD-Wählern und der Vorwurf des Populismus
Beide Politiker wurden mit dem Vorwurf konfrontiert, populistisch zu agieren, indem sie versuchen, Stimmen von der AfD zurückzugewinnen. Sahra Wagenknecht nannte diesen Vorwurf „völlig alberne“ und „absurd“. Sie sehe es als selbstverständlich an, Wähler, auch potenzielle AfD-Wähler, erreichen und überzeugen zu wollen. Das BSW habe bei seiner Gründung Menschen erreicht, die sonst AfD gewählt hätten. Die gesellschaftliche Debatte, die so tue, als würde die AfD nur von „lauter Nazis“ gewählt, sei „weit weg von der Realität“ und „unendlich arrogant gegenüber den Menschen“. Sie betonte, dass AfD-Wähler für bestimmte Inhalte wählten, darunter Frieden, die „völlig unkontrollierte Migration“, Meinungsfreiheit und die offene Debatte. Andere Parteien müssten die Sorgen dieser Wähler „viel ernster nehmen“, da dies der einzige Weg sei, die AfD zu schwächen und diese Wähler zurückzugewinnen.
Michael Kretschmer stimmte zu, dass über Jahre ausgeblendete Themen wie Migration ein „Vakuum“ gefüllt hätten, das die AfD stark gemacht habe. Er verwies auf Maßnahmen wie die Bezahlkarte und Grenzkontrollen als Schritte, um diese Themen anzugehen und den „Nährboden“ für Populismus zu entziehen. Er betonte die Notwendigkeit, „nah an den Themen der Leute“ zu sein, und nannte als Beispiel die Windkraft, wo Widerstand in der Bevölkerung zeige, dass Politik „demokratietauglich“ sein müsse. Er nannte es „anmaßend“, den Satz „es ist verwerflich AfD Wähler zurückzuholen“ zu äußern, da Wähler „niemandem gehören“. Kretschmer zog eine klare Trennlinie zwischen den Wählern und den Funktionären der AfD, wobei er den sächsischen AfD-Vorsitzenden und Höcke als „Neonazi“ und „Rechtsextremen“ bezeichnete, mit dem man nichts zu tun haben wolle. Er ist der Meinung, dass der „Fisch stinkt vom Kopf an“, aber die Wähler seien „doch nicht jetzt alle rechtsextrem geworden“, sondern hätten die Nase voll, weil Themen „über Jahre Jahre ausgeblendet worden“ seien. Sachsen sei ein „bürgerliches“ und „konservatives“ Land, das „bürgerlich konservative Politik“ wolle.
Krieg und Frieden: Aufrüstung, Diplomatie und Sanktionen
Eine der intensivsten Diskussionen drehte sich um die Frage, ob Aufrüstung zum Frieden führt. Sahra Wagenknecht lehnt eine radikale Pazifismus ab und erkennt die Notwendigkeit einer Bundeswehr zur Landesverteidigung an. Sie kritisierte jedoch die „irren Milliardensummen“ für Rüstung, die sie auf „wahnsinnigen Beschaffungsfilz“ und Lobbyismus zurückführte, da die Bundeswehr trotz steigender Budgets (mehr als Verdreifachung in 10 Jahren) Ausrüstungsmängel habe. Aktuelle Bestrebungen, wie die von Friedrich Merz geforderte größte Armee Europas oder ein unbegrenzter Blankocheck für Aufrüstung, seien „Kriegsvorbereitung“ und „ganz gefährlich“. Sie warnte vor einem „neuen deutschen Zeitgeist“, der mental auf einen Krieg mit Russland vorbereiten solle. Die Gefahr liege darin, in einen Krieg mit Russland hineinzukommen, nicht darin, dass Russland Deutschland überfalle. Sie ist überzeugt, dass kein konventioneller Panzer oder Drohne im Konflikt mit einer Atommacht helfe, und plädierte dafür, „alles tun [zu] müssen aus dieser jetzigen Spirale der Konfrontation rauszukommen“. Sie kritisierte eine leichtfertige öffentliche Kommunikation, die die Gefahr eines baldigen Krieges übertreibe.
Auf den Hinweis auf reale Bedrohungen durch russische Geheimdienste (z.B. Paket-Explosion in Leipzig) entgegnete Wagenknecht, dass Deutschland durch Waffenlieferungen, die gegen Russen eingesetzt würden und deren Koordination teilweise in Deutschland stattfinde, „ziemlich tief in einen Konflikt hinein[geraten]“ sei. Sie nannte die Nordstream-Explosion, die nicht von Russen verursacht wurde, als größten Anschlag auf deutsche Infrastruktur der letzten Jahre. Sie äußerte Skepsis gegenüber Medienberichten über russische Aktionen und verwies auf abweichende Darstellungen in der englischsprachigen Presse, was auf eine massive Bestrebung hindeute, die Bevölkerung auf einen Krieg mit Russland einzustimmen. Sie bezeichnete die Lieferung von Taurusraketen als Schritt, der Deutschland „ganz schnell in einen Krieg mit Russland bringen würde“, was ihr Angst mache. Sie ist überzeugt, dass ein Krieg zwischen NATO und Russland nuklear eskalieren würde, was auch Militärs wüssten. Sie argumentierte, dass Europa kaufkraftbereinigt bereits deutlich mehr für Rüstung ausgebe als Russland, selbst im aktiven Krieg.
Zur Vorgeschichte des Ukraine-Krieges sagte Wagenknecht, sie verurteile Politiker, die Kriege beginnen, aber man dürfe die Vorgeschichte nicht ausklammern. Sie bezeichnete die Annexion der Krim als historisch unwahr. Sie wies darauf hin, dass auf der Krim primär Russen lebten und es nach dem „weggeputschten“ Wahlergebnis nach dem Maidan und dem Wunsch der Ukraine nach NATO-Mitgliedschaft darum gegangen sei, dass Russland seinen Schwarzmeerflottenstützpunkt nicht verlieren wollte. Das Weglassen dieser Vorgeschichte sei historisch unwahr und tue so, als sei nur ein „wahnwitziger expansionswilliger Diktator am Werk“. Sie meinte, diese Vorgeschichte müsse diskutiert werden, um Fehler nicht zu wiederholen. Sie plädierte dafür, dass die Bevölkerung auf der Krim selbst über ihre Zugehörigkeit entscheiden sollte, ähnlich wie im Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg.
Zu Verhandlungen sagte Wagenknecht, Putin habe „sofort gesagt“, er wäre bereit zu einem Waffenstillstand, wenn die Waffenlieferungen eingefroren würden, was der Westen aber abgelehnt habe. Sie kritisierte das Vorgehen des Westens, der Verhandlungen erst nach dem Schweigen der Waffen verlange, und bezeichnete Versuche, Putin zu erpressen (z.B. mit Sanktionspaketen durch Herrn Merz), als „absurd“. Sie wünschte sich, dass Bundeskanzler Scholz auch nach Moskau reisen würde, um direkte Gespräche zu suchen. Sie stellte fest, dass die Ukraine vor drei Jahren in Istanbul eine „viel bessere Verhandlungsposition“ gehabt hätte als jetzt, was zeige, wie falsch die bisherige Strategie (Waffenlieferungen, Ignorieren von Verhandlungsbefürwortern) gewesen sei. Sie sprach sich dafür aus, den Konflikt einzufrieren und Sicherheitsgarantien zu geben, mit dem Ziel, dass zukünftige Generationen im Kreml eine Annäherung an den Westen suchen, statt auf eine militärische Rückeroberung der Krim zu setzen, was auf einen großen Krieg hinauslaufe.
Zur Sanktionspolitik sagte Wagenknecht, diese sei „völlig nach hinten losgegangen“ und habe Deutschland „ins eigene Knie geschossen“. Sie argumentierte, dass der Großteil der Welt sich nicht beteiligt habe und Russland als Rohstoffproduzent seine Abnehmer gefunden habe. Die Idee, Russland durch den europäischen Kaufstopp unter Druck zu setzen, sei „von vorne rein eine dumme Idee“.
Michael Kretschmer betonte die Notwendigkeit einer Bundeswehr, die das Land verteidigen kann. Er sah nach 2014 eine Zäsur und die Erkenntnis, dass man auf Angriffe vorbereitet sein müsse. Er ist der Meinung, dass Wladimir Putin „nur Stärke“ interessiert, nicht „romantische nette Dinge“. Kretschmer erinnerte an Putins Worte zum Zerfall der Sowjetunion als „größte Katastrophe des 20 Jahrhunderts“. Er sagte, er habe zu Beginn des Krieges für Diplomatie plädiert, hielt harte Sanktionen für besser als Waffenlieferungen und Waffenlieferungen für viel besser als in einen Krieg einzutreten. Er kritisierte, dass bei der Auswahl der Sanktionen und anderen wirtschaftspolitischen Entscheidungen nicht darauf geachtet wurde, dass Deutschland „vor allen Dingen stark sein muss um sich selber wehrhaft zu haben“, da viele Sanktionen Deutschland mehr schaden als Russland. Er betonte, dass Russland im Ukrainekrieg „viel mehr Panzer beispielsweise herstellt“ und „diese Durchhaltefähigkeit“ besitze, was eine Notwendigkeit zur Aufrüstung im Verteidigungsbereich zeige.
Kretschmer bestand darauf, Ross und Reiter zu benennen: Russland habe die Krim besetzt (2014) und sei in die Ukraine eingetreten; die Ukraine habe Russland nicht angegriffen. Dies könne nicht folgenlos bleiben, da es sonst wiederholt werde. Er bedauerte, dass Deutschland als „starkes Land in der Mitte Europas“ mit seiner Geschichte und Vertrauen seine Rolle in der Diplomatie verspielt habe und Europa nun „am Katzentisch sitzt“. Eine starke EU, die ihre Interessen definiert und durchsetzt, sei die „Lebensversicherung“.
Zu seinem früheren Vorschlag, den Krieg „einzufrieren“, bekräftigte Kretschmer, dass das Sterben aufhören müsse und ein Waffenstillstand kommen solle. Wichtig sei aber, dass die Ukraine „nicht als Territorium aufhört zu existieren“, sondern als „freies Land selbstbestimmt“ bleibe. Er räumte ein, dass die Ukraine jetzt in einer schlechteren Verhandlungsposition sei, was zeige, dass die Strategie der letzten Jahre falsch war. Dennoch sei das Ziel, dass die Ukraine ihr Land (auch die Krim) zurückerhält, aber nicht „auf dem kriegerischen Weg“, sondern durch Zeit und Diplomatie. Er hielt fest, dass seine Position zentral sei: „Es gibt keinen Grund auch keinen vorgeschobenen Grund für einen Angriff auf ein anderes Land weder in der Krim noch das was jetzt passiert“.
Zur Sanktionspolitik ergänzte Kretschmer, dass man sich die Sanktionen „im Detail anschauen“ müsse. Er wies auf Inkonsistenzen hin, wie die fortgesetzte kerntechnische Zusammenarbeit mit Russland für osteuropäische Partner, die russische Brennstäbe brauchen. Man müsse Sanktionen so gestalten, dass man sich „nicht so sehr betroffen“ fühle und sich nicht „selbst mehr schadet“. Er sah die Notwendigkeit, in eine neue Zeit einzutreten und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Rohstofflieferungen als Instrumente in Verhandlungen mit einzubringen, da dies für Russland ein relevanter Hebel sei.
Demokratie, Diskurs und Herkunft
Michael Kretschmer äußerte die Sorge um den Zustand der Demokratie mit dem Zitat: „Wir sollten die Demokratie verteidigen solange wir sie noch haben“. Er erklärte, dies spiegele eine Lücke zwischen Politik und Bevölkerung wider und sei eine Aufforderung zum bürgerschaftlichen Engagement (Parteimitgliedschaft, Zeitungslesen). Er glaubt, dass die Demokratie stabiler wäre, wenn mehr Menschen politisch und medial engagiert wären.
Sahra Wagenknecht berichtete, dass die Gründung einer neuen Partei in Deutschland „extrem schwer“ sei, viel schwerer als in anderen Ländern, aufgrund hoher Hürden und rechtlicher Anforderungen. Demokratie sei mehr als nur Wahlen; sie setze einen „freien breiten Diskurs in den Medien“ voraus, in dem „alle Meinungen“ berücksichtigt und öffentlich wahrgenommen würden. Sie kritisierte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es ihrer Meinung nach bei bestimmten Themen „nur noch eine Meinung“ gebe und andere „abqualifiziert“ würden (z.B. als Putinfreund oder Impffeind). Sie forderte eine Rückkehr zu einer „freien und auch respektvollen Diskussion“ über unterschiedliche Meinungen, um eine Verlagerung in „Filterblasen“ zu verhindern. Beide Politiker stimmten einer Aussage zu (von Wagenknecht geäußert, von Kretschmer bestätigt), dass das Meinungsklima abweichende Meinungen in die Nähe von Verschwörungstheorien rücke.
Angesprochen auf ihre eigene harte Wortwahl (Wagenknecht bezeichnete Scholz als „Vasallenkanzler“, Merz als „unsäglich“), verteidigte Wagenknecht dies, indem sie sagte, „breiter Diskurs und harte Polemik schließen sich nicht aus“. Sie begründete die Bezeichnung „Vasallenkanzler“ mit Deutschlands perceived Abhängigkeit von den USA, insbesondere bei Entscheidungen wie der Stationierung von Mittelstreckenraketen, die deutsche Interessen untergraben und am Bundestag vorbei entschieden würden. Sie wünschte sich mehr Eigenständigkeit Deutschlands. Wagenknecht sprach zudem von einer „cancel Culture“ und „Kontaktschuld“ in Deutschland, die dazu führe, dass Unterstützer des BSW aus Angst vor beruflichen Nachteilen zögerten, sich öffentlich zu bekennen. Sie nannte diese Angst ein „Armutszeugnis für ein liberales Land“.
Beide teilten ihre Erfahrung des Aufwachsens in der DDR. Michael Kretschmer hob hervor, wie prägend die Zeit nach 1990 war und wie schnell die soziale Marktwirtschaft und Freiheit den „Raubbau dieser DDR Diktatur beseitigt“ hätten. Sahra Wagenknecht erlebte die letzten Jahre der DDR bewusst als „bleierne Zeit“, durfte wegen Kritik nicht studieren und sah nach der Wende Hoffnungen durch die „unglaubliche Deindustrialisierung“ im Osten zerbrechen. Sie glaubt, dass Ostdeutsche dadurch Meinungsfreiheit mehr schätzten und kritischer gegenüber staatlichen und medialen Aussagen seien, sowie eine größere Sensibilität für die Notwendigkeit einer Wirtschaftspolitik hätten, die Industrie vor Zerstörung schütze.
Das Gespräch, das von den Moderatoren als fair und engagiert gelobt wurde, zeigte trotz aller Differenzen auch Schnittmengen, etwa in der Sorge um den gesellschaftlichen Diskurs oder der Kritik an Teilen der Sanktionspolitik. Es wurde deutlich, dass die Bewältigung der politischen Herausforderungen, sowohl in Sachsen mit einer Minderheitsregierung als auch auf Bundes- und internationaler Ebene, von der Bereitschaft zum Dialog und der Fähigkeit abhängt, auch über tiefe Meinungsverschiedenheiten hinweg ins Gespräch zu kommen – eine Herausforderung, die im Format „Politik in Sachsen“ an diesem Abend zumindest im Ansatz gemeistert wurde.