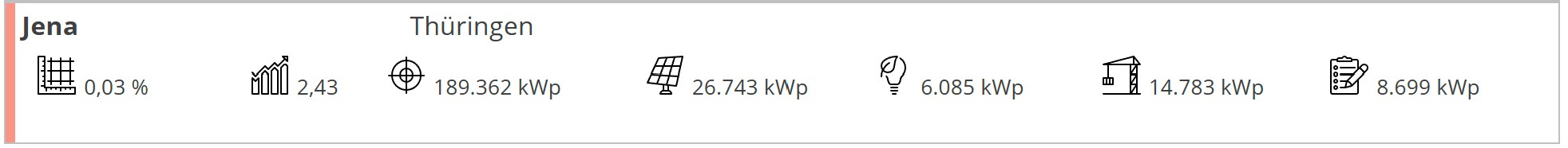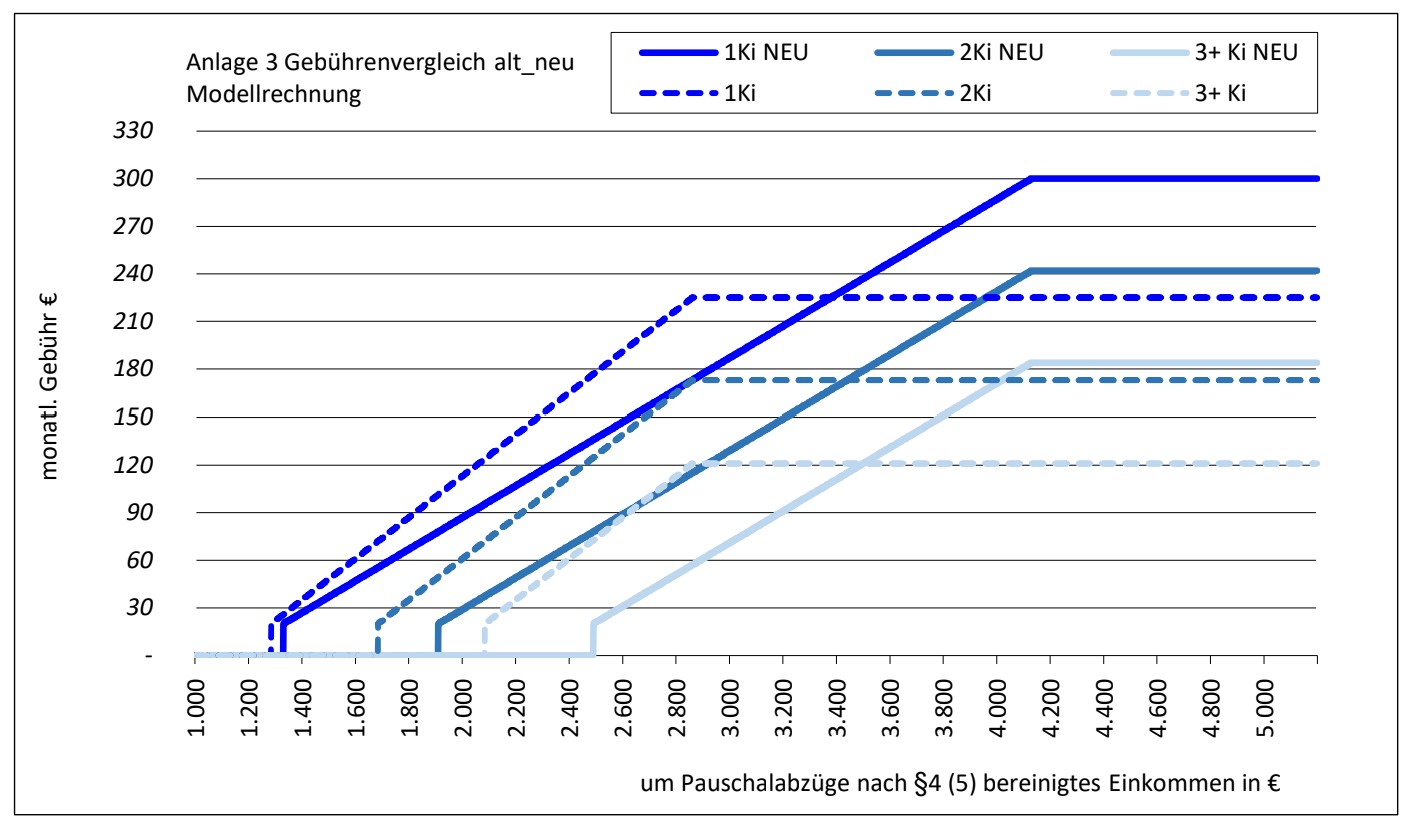Es ist ein Thema, das oft übersehen wird. Zwischen Diskussionen um Start-ups, Digitalisierung, Studierendenzahlen und urbaner Zukunftsplanung fällt eine Bevölkerungsgruppe regelmäßig durch das Raster: die älteren Menschen. In Jena leben heute rund 22.000 Menschen über 65 Jahre – Tendenz steigend. Im Jahr 2035 werden es laut Prognosen etwa 28.000 sein. Das sind fast ein Viertel aller Einwohner dieser Stadt. Und trotzdem scheint diese Realität in vielen politischen Konzepten nur am Rande eine Rolle zu spielen.
Ich frage mich: Wie kann es sein, dass in einer so innovativen und wohlhabenden Stadt wie Jena noch immer ältere Menschen in Wohnungen ohne Fahrstuhl leben müssen? In Stadtteilen wie Lobeda oder Winzerla, die ohnehin von Plattenbauten geprägt sind, stellt der tägliche Weg in den vierten oder fünften Stock für viele eine kaum zu bewältigende Hürde dar. Altersgerechtes Wohnen ist kein Luxus. Es ist ein Menschenrecht in einer alternden Gesellschaft. Und es ist eine gesamtstädtische Aufgabe, dafür Lösungen zu finden – nicht nur der Wohnungswirtschaft.
Mobilität im Alter – mehr als ein Ticket
Altern bedeutet nicht Stillstand, sondern verlangt Mobilität – im wörtlichen wie im gesellschaftlichen Sinn. Ein günstiges oder gar kostenfreies ÖPNV-Ticket für Seniorinnen und Senioren wäre ein kleiner Schritt mit großer Wirkung. Wer nicht mehr Auto fahren kann oder will, ist auf Bus und Bahn angewiesen. Wer aber dann feststellen muss, dass eine Monatskarte über 50 Euro kostet, überlegt es sich zweimal, ob er wirklich zum Seniorentreff, zum Markt oder zur Theateraufführung fährt – oder doch lieber zu Hause bleibt.
Und noch immer ist nicht jede Haltestelle barrierefrei, sind Bordsteine zu hoch, Fahrpläne unübersichtlich, Sitzplätze rar. Wenn Teilhabe am gesellschaftlichen Leben kein leeres Wort bleiben soll, dann muss Mobilität als soziale Infrastruktur begriffen werden – nicht als Nebensache.
Stadtentwicklung mit Weitblick – für alle Generationen
Jena ist stolz auf seine Innovationskraft, auf wissenschaftliche Exzellenz, auf junge Köpfe. Zu Recht. Aber Stadtentwicklung darf nicht exklusiv sein. Es geht nicht darum, für die eine Generation das Beste zu schaffen – sondern für die ganze Stadtgesellschaft. Noch gibt es in Jena freie Flächen – auf dem Eichplatz, entlang der Bachstraße oder im Umfeld der neuen Uni-Standorte. Was dort entsteht, wird die nächsten Jahrzehnte prägen. Wer dort nur an Büros, Lofts und urbanes Design für eine junge Zielgruppe denkt, macht einen schwerwiegenden Fehler.
Warum nicht generationenübergreifende Wohnquartiere schaffen? Mit altersgerechten Wohnungen, kurzen Wegen, Gesundheitszentren, Gemeinschaftsräumen, grünem Rückzugsraum – und bezahlbar für Rentnerinnen und Rentner mit kleiner Rente. Warum nicht Stadtteilzentren mit Beratungsangeboten, Nachbarschaftshilfe, Kulturprogrammen für Ältere, digitalen Schulungen, Hilfe bei Anträgen, Einkaufsmöglichkeiten und sozialen Kontakten? Es fehlt an Fantasie? Nein. Es fehlt an politischem Willen.
Engagement vor Ort – Initiativen machen Mut
Zum Glück gibt es in Jena auch Lichtblicke. Die Wohnbaugenossenschaft „Carl Zeiss“ entwickelt barrierearme Wohnformen. Die AWO betreibt Quartiersmanagement-Projekte in Winzerla, die sich gezielt an ältere Menschen richten. Auch in Lobeda engagiert sich das Bürgerzentrum LISA für ein Miteinander der Generationen. Das Projekt „Alt werden in Jena“ vernetzt Akteure aus Sozialarbeit, Pflege, Stadtverwaltung und Ehrenamt. Doch all diese Initiativen kämpfen mit begrenzten Mitteln gegen eine strukturelle Vernachlässigung. Sie verdienen mehr Unterstützung, auch finanziell.
Alter ist kein Randthema
Diese Stadt wird älter. Das ist keine Bedrohung. Das ist eine Chance. Ältere Menschen haben Wissen, Erfahrungen, Zeit – und ein berechtigtes Bedürfnis nach Teilhabe, Sicherheit und Würde. Wer heute 70 ist, kann noch viele Jahre aktiv das Stadtleben mitgestalten – wenn man ihn lässt. Es liegt an uns, ob wir Altern als gesellschaftliches Defizit oder als integralen Teil unserer städtischen Identität begreifen.
Wenn wir über die Zukunft von Jena reden, dann müssen wir auch über den Alltag von Seniorinnen und Senioren reden. Über Gehwege und Fahrstühle, über Nachbarschaft und Einsamkeit, über Wohnformen und Preise, über Mobilität und Teilhabe. Und dann, ja dann, hätten wir wirklich eine soziale, zukunftsfähige Stadtpolitik. Noch ist es nicht zu spät.