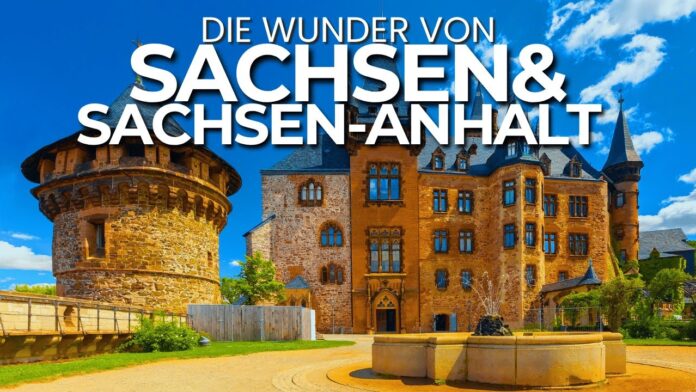Einst war es das Herz der Energieversorgung der DDR, ein Ort, der fast das gesamte Land mit Strom, Briketts und Gas aus Braunkohle belieferte und damit eine einzigartige Stellung in Europa einnahm. Heute steht in Schwarze Pumpe das höchste Gebäude Brandenburgs, das Braunkohlekraftwerk, gelegen in der Lausitz zwischen Spremberg und Hoyerswerda. Dieses Areal, ein Relikt des fossilen Zeitalters, ist nicht nur ein Ort der Industriegeschichte, sondern auch Zeuge immenser Umweltbelastungen und erzählt die Geschichte eines Aufbruchs, der Tausende Menschen in die Lausitz lockte und für eine Atmosphäre sorgte, die als „Wildwest tief im Osten“ beschrieben wird.
Der Schatz unter den Kiefern
Im Mai 1955 wurde ein Fremder durch die endlosen Kiefernwälder der Lausitz chauffiert. Sein Ziel: ein Gasthaus in der Trattendorfer Heide. Was für den Besucher, den DDR-Minister für Schwerindustrie Fritz Selbmann aus Berlin, wie eine „Kieferneinöde“ wirkte, barg einen Schatz: Braunkohle. Mit der Teilung Deutschlands war der Zugang zur Steinkohle aus dem Ruhrgebiet und dem Saarland blockiert, und Importe reichten nicht aus. Die DDR-Regierung plante hier ein riesiges Energiekombinat, samt gigantischer Tagebaue, das förmlich aus dem Boden gestampft werden sollte. Aus Braunkohle sollten erstmals in einem integrierten Werkskomplex nicht nur Briketts, sondern vor allem Strom, Gas und Koks erzeugt werden. Dies war von entscheidender Bedeutung, da es in Ostdeutschland keinen hochofenfähigen Koks gab, der ohne Stahl keinen Aufbau ermöglichte.
Der Name des Werkes stammt von eben jenem Gasthaus „Schwarze Pumpe“, in dem Minister Selbmann 1955 abstieg und mit Einheimischen ins Gespräch kam, um die großen Pläne vorzustellen. Bald zog der Aufbau des geplanten Energiegiganten in das Gasthaus ein.
Gigantische Dimensionen und harte Arbeit
Das Großvorhaben kostete die DDR in den kommenden Jahren 1,1 Milliarden Mark. Drei Baustufen waren geplant. Günther Seifert, der 1961 als Student die Riesenbaustelle besuchte und später dort arbeitete, war tief beeindruckt: Die Dimensionen waren gewaltig, das Werksgelände 6 km lang und 3 km breit. Man spürte, dass hier Zukunft aufgebaut wurde.
In nicht einmal 10 Jahren entstanden drei Brikettfabriken, drei Großkraftwerke, eine Aufbereitungsanlage für Braunkohlen-Hochtemperaturkoks und ein Werk für die Produktion von Stadtgas. Doch die Bauzeit war viel zu knapp bemessen, es gab Verzögerungen und Probleme mit den Veredlungstechnologien. Günther Seifert begann 1963 im Alter von nur 28 Jahren als Hauptabteilungsleiter im Gaswerk, konfrontiert mit einem Generalproblem: Die Technologien waren alle nicht erprobt. Die Vorbereitungszeit von 1955 bis zur Inbetriebnahme des Gaswerkes 1964 hatte als Entwicklungszeit nicht ausgereicht. Der physische Einsatz Tag und Nacht war gefordert. Der Jahrhundertwinter 1963 mit Dauerfrost erschwerte die Arbeiten zusätzlich.
Das Gaswerk, fertiggestellt im Frühjahr 1964, sollte fast das Gesamtaufkommen der DDR an Stadtgas aus Braunkohle produzieren. Gasleitungen wurden im ganzen Land verlegt, der Termindruck und die Erwartungen waren gewaltig. Zweifel am Gelingen waren nicht erlaubt; die junge DDR brauchte Erfolge und wollte Heldengeschichten schreiben. Arbeiter, deren Hände dies ermöglichten, erhielten staatliche Auszeichnungen, da sie halfen, die DDR trotz fehlenden Ruhrgebietes zu einem hoch entwickelten Industriestaat zu machen.
Ein Mythos und seine Schattenseiten
Der Cottbuser Fotograf Erich Schutt dokumentierte über Jahrzehnte den Aufbau und das Arbeitsleben, setzte den Menschen, die hier unter Anstrengungen und Entbehrungen lebten und arbeiteten, ein Denkmal. So entstand der Mythos Schwarze Pumpe – einer neuen Welt mit sozialistisch arbeitenden, lebenden und lernenden Menschen.
Dieser Mythos bekam jedoch Risse. Der DEFA-Film „Spur der Steine“ (1966) zeigte eine kritische Sicht auf die Aufbaujahre, die Planwirtschaft wurde kritisch aufs Korn genommen, was zum Verbot des Films führte. Manfred Krug verkörperte als Brigadier Baller einen Arbeiter, der bei den DDR-Oberen auf Ablehnung stoßen musste, auch wegen der nicht seltenen Ausschweifungen und nächtlichen Exzesse. Die Kneipen in Spremberg und Hoyerswerda waren gut gefüllt, der hart verdiente Lohn wurde in Bier und Schnaps umgesetzt.
Gutes Geld und neuer Wohnraum lockten die meisten Menschen an. In Hoyerswerda entstand ab 1957 eine ganz neue Stadt aus Plattenbauten, die vom 7.000-Einwohner-Ort zum städtebaulichen Experimentierfeld wurde. Man baute schnell, um die Stadt wachsen zu lassen, und bis in die 80er Jahre entstand Wohnraum für mehr als 70.000 Menschen. Ein besonderer Standard waren zum Beispiel fernbeheizte Wohnungen mit warmem Wasser aus der Wand und Aufzügen.
Landschaftszerstörung und Umweltprobleme
Doch Schwarze Pumpe schuf nicht nur Existenzen, sondern zwang auch viele, Haus und Hof zu verlieren. Das Werk benötigte Unmengen an Braunkohle; die Fördermenge mehr als verdoppelte sich allein von 1955 bis 1960. Felder, Wald und Dörfer mussten neuen Tagebauen weichen. Besonders betroffen war das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben, deren Sprache und Kultur erheblich unter der Energiepolitik der DDR litt. Bis 2006 verschwanden mehr als 135 Gemeinden in der Lausitz durch den Bergbau, ein Großteil im sorbischen Siedlungsgebiet.
Schwarze Pumpe entwickelte sich zu einem der größten Umweltverschmutzer der DDR. Reiner Großer, der Anfang der 80er Jahre in Sprewitz (ein Dorf direkt vor der Haustür des Werkes) sein Haus baute, erlebte die Luftverschmutzung als kaum auszuhalten. Es kam sehr viel Kohlenstoff herunter, der mit Wasser von Flächen und Wänden abgewaschen werden musste – die Wasserkosten übernahm Schwarze Pumpe.
Ein weiteres Problem war die Gasherstellung aus Braunkohle mittels Druckvergasung. Obwohl das Verfahren technisch weiterentwickelt wurde, verursachte die Lausitzer Kohle riesige Staubmengen. Ein handfestes Problem war der anfallende Teerschlamm. Der Platz für Teerdeponien auf dem Werksgelände reichte nicht, und bis zu 700.000 Tonnen Teer mussten im Umland als Teiche gestapelt werden. Dies verursachte einen riesigen Gestank, eine Gefahr für das Grundwasser und beeinträchtigte die umliegenden Dörfer wie Sprewitz, Terpe und Zerre, die bald als das „schwarze Dreieck“ bezeichnet wurden. Reiner Großer beschreibt den Geruch im Sommer als so stark, als würde man neben einer Asphaltmaschine laufen.
Zusätzlich fuhr das Werk Ende der 70er Jahre immer öfter auf Verschleiß, um für marode Energiewerke anderswo einzuspringen. Filter, die für 17 Tonnen Durchlass ausgelegt waren, wurden mit 22-23 Tonnen belastet. So gingen pro Stunde etwa 8 Tonnen Staub übers Dach weg, was auf 100.000 Tonnen Kohle pro Jahr hochgerechnet wurde, die in die Umwelt gelangten. Dies war nicht zu verbergen: Hoyerswerda hatte eine der höchsten Sterberaten an Lungenkrebs in der DDR. Zwar lag die Stadt auf der windabgewandten Seite, doch die Dörfer Sprewitz, Terpe und Zerre waren direkt betroffen, da der Dreck meistens nach Osten ging.
Reiner Großer hielt nicht den Mund, legte sich als Gemeinderatsvertreter mit den Werksdirektoren an und stritt für Umweltschutz, Wasser- und Reinigungsgeld für die Anwohner. Obwohl ihm Wirtschaftsspionage nachgesagt wurde, konnte er im Werk bleiben, wenn auch unter Beobachtung.
Katastrophe und Neuanfang
Die fatale Ignoranz gegenüber der Umwelt und auch hinsichtlich der Sicherheit führte zu einer explosiven Mischung. Am 22. Februar 1982 ereignete sich im Gaswerk von Schwarze Pumpe eines der schlimmsten Unglücke der DDR-Industriegeschichte: eine Explosion nie dagewesenen Ausmaßes. Riesige Gasmengen traten aus; wäre eine Zündquelle vorhanden gewesen, hätte es eine Katastrophe für die Energieversorgung der DDR bedeutet. Die Werksfeuerwehr, eine der größten der DDR, stand vor der Herausforderung, nicht nur Menschenleben, sondern auch die Energieversorgung zu retten. Unter Einsatz aller Kräfte konnte die Gasversorgung durch die verbliebenen Anlagen in wenigen Tagen wiederhergestellt werden. Der anfängliche Verdacht auf Sabotage bestätigte sich nicht; die Katastrophe hatte eine technische Ursache.
Trotz aller Umweltprobleme stand das Werk auch für innovative Verfahren. Um die Teerprobleme zu lösen, entwickelten Ingenieure mit sowjetischen Kollegen ein bahnbrechendes Verfahren: die Staubdruckvergasung. 460 Millionen Mark wurden aus den eigenen Finanzen investiert, um diesen „Befreiungsschlag“ zu erreichen, bei dem Teere und Öle aus den Abprodukten verschwanden. Die Technologie wurde Mitte der 80er Jahre in Angriff genommen, konnte ihre Umwelteffekte aber nicht mehr ausspielen, da mit der Wende die Braunkohleindustrie im Osten abgewickelt wurde. Der Siemens Konzern kaufte die Lizenzen für einen symbolischen Betrag, und heute laufen solche Generatoren in China zur Benzinerzeugung aus Kohle.
Das Ende einer Ära und die Suche nach dem Strukturwandel
Obwohl Schwarze Pumpe bis zur Wende als Vorzeigebetrieb galt, kam mit der Marktwirtschaft das Aus für die Kohleveredlung. Westdeutsche Energiekonzerne führten die Stadtgasproduktion aus Braunkohle nicht weiter. Die Braunkohleförderung wurde massiv zurückgefahren, viele Beschäftigte kamen in der Sanierung unter. Der Rückbau verschlingt bis heute über 12 Milliarden Euro. Die Ironie: Diejenigen, die das Werk aufbauten, übernahmen den Abriss, da sie sich am besten auskannten. Zunächst wurden die jüngeren, oft leistungsfähigen Mitarbeiter entlassen, auch über Sozialauswahl, was bei vielen schmerzlich war.
Kraftwerke und Brikettfabriken wurden gesprengt, um Investoren eine grüne Wiese anzubieten. Die spektakulären Sprengungen wurden von den einst stolzen Kumpeln mit einer Mischung aus Faszination und Trauer verfolgt.
Auch in Hoyerswerda schlug sich der Abbruch nieder. Die Einwohnerzahl sank in 10 Jahren von 75.000 auf 33.000. Die einst stolze Vorzeigestadt wurde zum sozialen Pulverfass, und rechtsextreme Ausschreitungen machten Schlagzeilen. Spremberg hatte ebenfalls Probleme mit gewaltbereiten Neonazis.
Trotz aller Probleme versucht sich der ehemalige Energiebezirk in die neue Zeit zu retten. Es wird an der Braunkohle festgehalten und kräftig investiert: In Schwarze Pumpe entstand das damals modernste Braunkohlekraftwerk, das 1997 von Bundeskanzler Helmut Kohl als „Signal des Aufbruchs“ in Betrieb genommen wurde. Dieses Kraftwerk ist, obwohl von Liedermacher Gerhard Gundermann besungen, tatsächlich sauberer geworden.
Altlasten und neue Hoffnungen
Damit Schwarze Pumpe eine Zukunft hat, müssen die Altlasten verschwinden. Noch 30 Jahre nach Stilllegung belastet der giftige Teer aus der Braunkohleveredlung den Untergrund. Kontaminiertes Erdreich wird ausgebaggert und in einer Spezialfabrik gewaschen. Wer hätte gedacht, dass die Altlastensanierung noch Arbeitsplätze sichert?
Altlastenfreie Areale sind zwingend notwendig für die Ansiedlung neuer Betriebe. Zwischen dem neuen Kraftwerk und der Brikettfabrik hat sich 2005 eine der größten Papierfabriken Europas angesiedelt, die über 700 Menschen beschäftigt. Schwarze Pumpe will auch nach dem Kohleausstieg Energiestandort bleiben. Startups sollen im Innovationscenter andocken. Im Sommer 2021 wurden Pläne für ein Wasserstoff-Referenzkraftwerk vorgestellt, das überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff speichern und bei Bedarf wieder verstromen soll – ein bis jetzt einzigartiges Pilotprojekt in Europa.
Die große Hoffnung ist, die modernen Technologien und vor allem die Qualifikationen der Menschen für die Zeit nach der Kohle zu nutzen. Unternehmen exportieren Bergbau-Know-how in die Welt. Die Verbundenheit mit dem Bergbau und die Kenntnis der Technologien sollen für Exportprojekte genutzt werden. Der Gruß „Glück Auf“ wird nur noch von wenigen gerufen, da man langsam aus der Braunkohle ausläuft und sich andere Geschäftsfelder überlegen muss.
Monika Hanke, die älteste Steigerin in Europas letzter Brikettfabrik, hat ihr ganzes Arbeitsleben in Schwarze Pumpe verbracht. Mit dem beschlossenen Kohleausstieg wird auch dieses Werk schließen. Sie hat Sozialismus, Wende und Marktwirtschaft erlebt und weiß, dass hier und jetzt eine Ära zu Ende geht. Der Ausstieg mag ihr persönlich etwas zu schnell erscheinen, aber sie kann damit umgehen.
Der Energiegigant Schwarze Pumpe hat die Landschaft radikal verändert. Die immense Luftverschmutzung gehört der Vergangenheit an, und vieles hat sich zum Besseren gewendet. In unmittelbarer Nachbarschaft des Werkes kann der Naturführer Carsten Nitsch heute Touren anbieten, da sich in ehemaligen Tagebauen eine neue Wildnis entwickelt hat. Die Narben der Braunkohleindustrie verheilen allmählich. Es braucht Zeit und Geduld, aber es passiert.
In mehr als 7 Jahrzehnten hat sich Schwarze Pumpe immer wieder neu erfunden und die Menschen in der Lausitz immer wieder aufs Neue gefordert. Die Reise geht weiter – in Richtung erneuerbare Energien und eine post-fossile Zukunft.