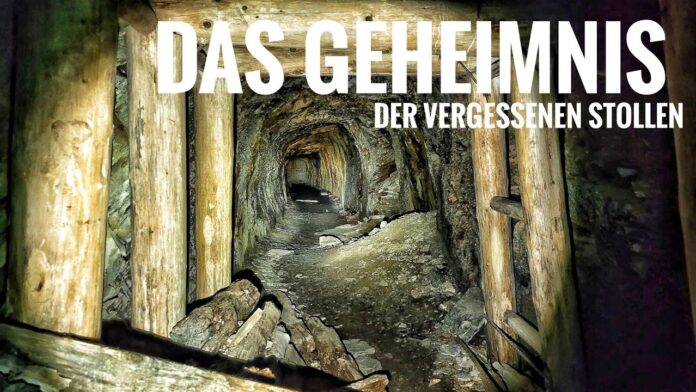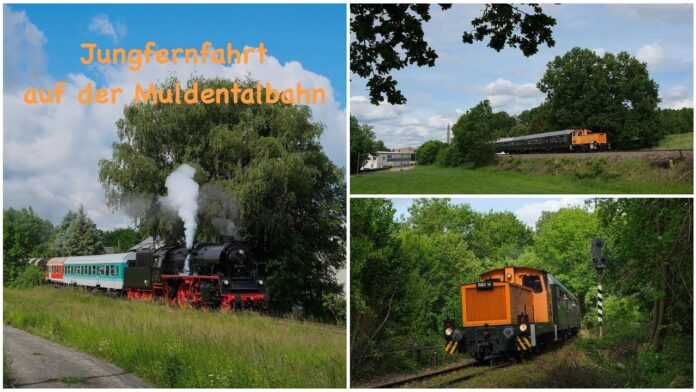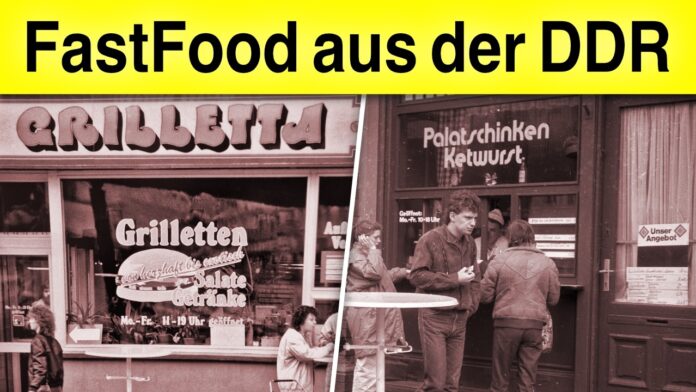Tutzing. Nach 35 Jahren deutscher Einheit blickt Deutschland auf eine Geschichte voller Hoffnungen, Enttäuschungen und anhaltender Unterschiede zurück. Dr. h.c. Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident a.D., beleuchtete auf der Frühjahrstagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing im März 2025 die „Deutsch-deutschen Trennlinien und Verbindungslinien“. Sein Vortrag, gehalten aus explizit ostdeutscher Perspektive, zeichnete ein Bild eines Landes, das trotz weitgehender Angleichung in vielen Bereichen noch immer tief gespalten erscheint – eine Spaltung, die sich zuletzt in Wahlergebnissen auf beunruuhigende Weise manifestierte.
Eine verpasste Chance und anhaltende Enttäuschungen
Thierse erinnerte an einen Essay von 1992 mit dem Titel „Zwei Welten oder eine?“, dessen Aktualität ihn „gestürzt“ habe. Schon damals konstatierte er, dass die historische Möglichkeit, den Einigungsprozess als gemeinsame identitätsstiftende Leistung zu begreifen, ungenutzt geblieben sei. Die Solidaritätserfahrung der Ostdeutschen konnte in Gesamtdeutschland nicht recht erlebt werden, da die Hilfe oft als „umstritten“ und „allzu unwillig gewährt“ erschien. Dieses Defizit habe Deutschland einen Preis gekostet.
Er zitierte seinen damaligen Wunsch an die Westdeutschen: Sie mögen begreifen, dass sich auch bei ihnen etwas ändern müsse, dass die „unerhörte Begebenheit“ der Einheit auch für sie Folgen haben werde, wie eine „neue Kultur der Bescheidung“. Das Scheitern, die deutsche Welt gemeinsam zu verändern und die Wahrheit zuzulassen, sei ein mühseliger erster Schritt geblieben.
Wahlergebnisse als Spiegel der Spaltung
Die Bundestagswahl vier Wochen vor Thierses Vortrag zeigte „ein deutlich gespaltenes, übellauniges Land“. Die alte innerdeutsche Staatsgrenze sei in den Wahlergebnissen überdeutlich sichtbar. Die AfD ist demnach im Osten, außer in Ostberlin, mit großem Abstand stärkste Kraft geworden, während sie im Westen die größten relativen Zuwächse verzeichnete. Die Ursachen dafür seien komplex und gingen über einfache Erklärungen wie niedrige Einkommen oder hohe Arbeitslosigkeit/Ausländeranteil hinaus. Thierse spekuliert, dass Ostdeutschland vielleicht eine „politische Vorreiterin, eine Avangarde in Richtung auf ein autoritäres Zeitalter“ sein könnte. Ein Zitat aus der „Zeit“ deutet auf ein mögliches „Abkoppeln des Ostens von politischen Gepflogenheiten des Westens“ hin.
Die Last der Geschichte und unterschiedliche Prägungen
Die Teilung in zwei Staaten mit gegensätzlichen Systemen über 40 Jahre habe zu einer „auseinanderstrebenden Entwicklung“ geführt. Während die Bundesrepublik eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte mit Wirtschaftswachstum, Wohlstand und stabiler Demokratie erlebte und Teil der westlichen Gemeinschaft wurde, endete der „kommunistische Großversuch unter sowjetischer Aufsicht“ in der DDR nach Brutalitäten, Massenflucht und dem Mauerbau in einem „eingesperrten Land“, das sich ständig mit der Bundesrepublik messen musste und scheiterte. Dieses Scheitern war laut Thierse nicht nur eine Folge der friedlichen Revolution, sondern auch ein „wirtschaftlicher und ein ideologisch-moralischer Zusammenbruch“.
Der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes 1990 sei unter extremem Zeit- und Problemdruck geschehen und markiere die Vereinigung „von zwei Ungleichen, von einem erfolgreichen und einem gescheiterten System“. Im Westen wirkte der Zusammenbruch als Bestätigung des Status quo – man sah keinen Grund, sich zu ändern. Im Osten musste sich scheinbar alles ändern, was zu einem schmerzlichen, ungleichen Beziehungsverhältnis führte. Hinzu kam der schmerzliche und oft ungerechte Elitenwechsel.
Das Gefühl der Demütigung und der „ostdeutsche Minderwertigkeitskomplex“
Viele Ostdeutsche erlebten die Transformations- und Umbruchsprozesse der 90er und 2000er Jahre mit einem Gefühl von Demütigung und Zurücksetzung. Dieses Gefühl werde von „Empörungsagenturen“ befeuert, heute besonders von der AfD, die „einen offensichtlich erfolgreichen Verbitterungspopulismus betreibt“. Thierse beklagt die „Unfähigkeit und Unwilligkeit vieler Ostdeutscher zu positiver Selbstwahrnehmung“, betont aber gleichzeitig die „große menschliche, soziale und kulturelle Leistung“ bei der Bewältigung der Transformation.
Er spricht von einem „sehr ostdeutschen Minderwertigkeitskomplex“, der nicht erst seit den 90er Jahren existiere, sondern durch das ständige Leben mit dem Blick nach Westen und das Empfinden, die „schwächeren, weniger erfolgreichen Deutschen“ zu sein, geprägt sei.
Minderwertigkeitsgefühle machen wütend, und das ostdeutsche Selbstbewusstsein sei „empfindlich und labil“ und verlange nach Anerkennung.
Harte Fakten und tiefer liegende Unterschiede
Obwohl die sozialökonomischen Unterschiede zwischen Ost und West in den letzten 35 Jahren durch Anstrengungen und Angleichungsprozesse deutlich geringer geworden sind (z.B. bei BIP pro Kopf, Produktivität, Einkommen, Arbeitslosenquote, Rentenwert), bestehen weiterhin Differenzen, insbesondere beim Vermögen. Ostdeutschland sei noch keine Erbengesellschaft wie der Westen. Auch in der Altersstruktur und Bevölkerungsentwicklung gibt es deutliche Unterschiede.
Besonders auffällig sind die Differenzen bei der Repräsentation: Ostdeutsche sind nur zu 11,2% in Elitenpositionen vertreten, bei einem Bevölkerungsanteil von 19%. Religiösität ist im Osten deutlich geringer, der Ausländeranteil ebenfalls, während ausländerfeindliche Einstellungen deutlich höher seien.
Der Kulturprozess als eigentliche Herausforderung
Für eine Mehrheit der Westdeutschen überwiegen laut Thierse die Gemeinsamkeiten (57%), während für eine Mehrheit der Ostdeutschen die Unterschiede überwiegen (57%). Dies sei der „Wunde Punkt“ und bestätige, dass die deutsche Einigung nicht nur ein politischer, rechtlicher oder ökonomischer, sondern ebenso sehr ein kultureller Prozess ist – der mühsamere und konfliktreichere Teil.
Diese kulturellen Prägungen resultieren aus 40 Jahren Leben in einer SED-Diktatur, einem fürsorglichen, aber auch bevormundenden und mangelhaften Staatssystem im Gegensatz zu einer offenen, pluralistischen Wettbewerbsgesellschaft. Erlebnisse wie die „grimmige Idylle einer Notgemeinschaft“ in der DDR hätten ein starkes Solidaritätsbedürfnis geprägt, während die Gesellschaft der Freiheit oft als „kalt“ empfunden werde.
Schwächere Zivilgesellschaft und ambivalente Staatsfixierung
Die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland sei schwächer ausgeprägt, mit deutlich niedrigeren Mitgliedschaften in Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Vereinen. Thierse zitiert Ralf Dahrendorfs Prognose von 1991, wonach der Aufbau von Staat und Wirtschaft Jahre dauere, die Entwicklung einer selbstbewussten Zivilgesellschaft aber 60 Jahre benötige – eine aus seiner Sicht realistische Einschätzung.
Ein weiteres Nachwirken sei ein starkes Gleichheitsbedürfnis und der Wunsch nach sozialer Harmonie und kultureller Homogenität, was die Gewöhnung an eine konfliktreiche, pluralistische Gesellschaft erschwere. Viele Ostdeutsche schienen eine „eigentümlich ambivalente Staatsfixierung“ mit sich zu tragen: Der DDR-Staat war allzuständig, man erwartete alles von ihm, verachtete ihn aber auch zutiefst, als er nicht lieferte. Dies habe eine „zutiefst autoritäre Prägung“ hinterlassen, die fortwirke – man erwarte alles „von denen da oben, vom Westen“ und verachte System und Personal, wenn die erwarteten „Wunder“ ausblieben.
Die autoritäre Versuchung: Eine globale und deutsche Aufgabe
Thierse betont, dass die beschriebenen Phänomene nicht nur Vergangenheit oder spezifisch ostdeutsch seien. Die autoritäre Versuchung ist ein globaler Trend, Demokratien sind weltweit auf dem Vormarsch. In Zeiten von multiplen Krisen und schmerzhaften Veränderungsnotwendigkeiten stehe Deutschland als „wichtigste Demokratie der Welt“ (Tim Snyder) in besonderer Verantwortung.
Die gemeinsamen Herausforderungen – Kriege, Klimakatastrophe, Migration, Digitalisierung, ökologische Überlebenspolitik – müssten eigentlich verbinden. Der eigentliche Kraftakt sei es, politische Zusammenhaltung und soziale Gerechtigkeit zu sichern, auch angesichts potenziell geringeren materiellen Wohlstandswachstums und härterer Verteilungskonflikte. Dies sei die „Bewährungsprobe für unseren demokratischen Zusammenhang und den Zusammenhalt zwischen West und Ost“.
Ein entscheidender Unterschied liege auch in der Vorstellung von Demokratie: Viele Menschen im Osten hätten eine andere Vorstellung, preferring direkte Demokratie, den unmittelbaren Vollzug des Volkswillens und klare Führung gegenüber der repräsentativen, mühsamen Parteiendemokratie. Diese Vorstellung, dokumentiert durch die Wahlergebnisse autoritärer Parteien wie AfD und BSW, sei eine riesige Herausforderung für das etablierte politische System.
Die Zukunft der Freiheit
Thierse schließt mit der Pflicht der Demokraten, der autoritären Versuchung zu widerstehen. Dies sei nicht nur eine ostdeutsche, sondern eine globale und gesamtdeutsche Aufgabe. Es gehe letztlich um die Zukunft der Freiheit, die – so die ernüchternde Einsicht – nicht identisch sein müsse mit ständigem Wirtschaftswachstum und Wohlstandsnährung. Die notwendige „Selbsthaltung der Menschheit“ könne nur als gemeinschaftliches Projekt gelingen.
Die Debatte um deutsche Einheit und Teilung bleibt auch 35 Jahre danach eine hochaktuelle und emotional aufgeladene Frage, die grundlegende Herausforderungen für die Zukunft der Demokratie in Deutschland aufzeigt.