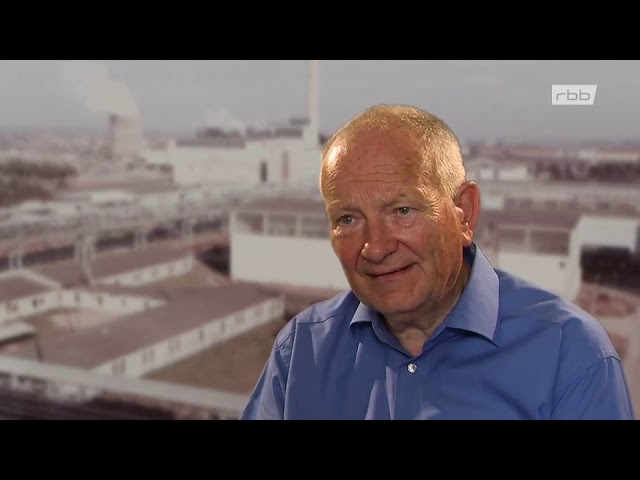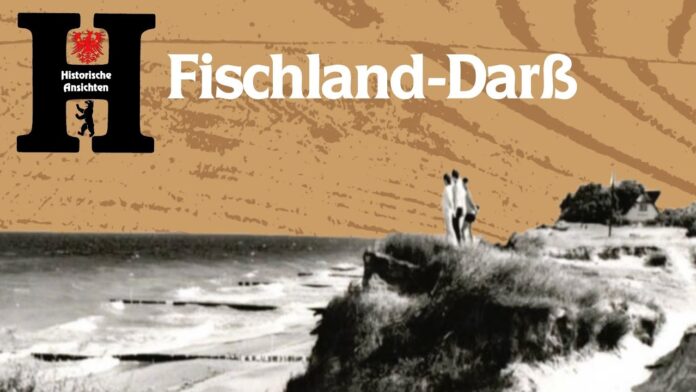Die Flucht von Wolfgang Hilgert und den Brüdern Hans-Joachim und Jürgen Zorn aus einem kleinen Dorf bei Magdeburg gehört zu den beeindruckendsten Geschichten über den Versuch, der DDR zu entkommen. Diese drei Männer planten ihre Flucht mit einem ungewöhnlichen und spektakulären Fahrzeug: einer Planierraupe. Was als eher lockere Idee begann, entwickelte sich schließlich zu einem waghalsigen Fluchtplan.
Die drei Freunde lebten zunächst recht zufrieden in der DDR. Sie waren handwerklich geschickt und schraubten und schweißten regelmäßig an Autos. Diese Leidenschaft für Technik ermöglichte es ihnen, durch geschicktes Tauschgeschäft an begehrte Konsumgüter zu gelangen, die im sozialistischen System der DDR schwer zu beschaffen waren. Trotz ihrer relativen Zufriedenheit mit diesem Lebensstil wuchs allmählich der Frust über die Mangelwirtschaft, die Bevormundung durch den Staat und die ständige Überwachung. Westdeutsches Fernsehen, das ihnen das Leben jenseits der Grenze in glänzenden Bildern zeigte, verstärkte den Wunsch, den grauen Alltag hinter sich zu lassen.
Irgendwann wuchs in ihnen der Entschluss, der DDR zu entfliehen. Sie wollten nicht länger in einem Land leben, das ihre Freiheit einschränkte. Ihr Plan war ebenso mutig wie riskant: Mit einer Planierraupe wollten sie die befestigte innerdeutsche Grenze durchbrechen. Die DDR war von rund 1.400 Kilometern Stacheldraht und Todesstreifen durchzogen, die streng überwacht wurden. Dennoch wagten sie das Unmögliche.
Der Coup gelang ihnen: In einer spektakulären Nacht durchbrachen sie mit ihrer Raupe die Sperranlagen und schafften es, in den Westen zu fliehen. Für die drei Männer bedeutete dies das ersehnte freie Leben im Westen, doch die Flucht hatte auch Schattenseiten. Ihre Familien, die in der DDR zurückblieben, mussten die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen. Die Stasi nahm die Angehörigen der Flüchtigen ins Visier, schikanierte und überwachte sie.
Diese Frage, ob die Flucht das Leid der zurückgebliebenen Familienmitglieder wert war, blieb den Männern sicher lange im Kopf. Sie hatten die Freiheit erreicht, die sie suchten, doch der Preis dafür war hoch. Sieben Jahre später, 1989, fiel die Berliner Mauer, und die innerdeutsche Grenze, die so viele Menschen das Leben gekostet hatte, existierte nicht mehr.
Die Flucht mit der Raupe ist eine Geschichte, die den Mut und die Verzweiflung der Menschen in der DDR zeigt, aber auch die schwierigen moralischen Entscheidungen, die viele Flüchtlinge treffen mussten. Es ist ein Beispiel für den unbeugsamen Wunsch nach Freiheit, aber auch ein Mahnmal dafür, dass Fluchten immer persönliche und familiäre Tragödien nach sich ziehen können.