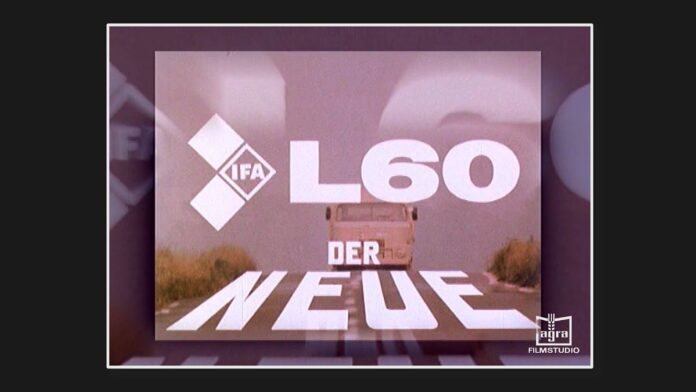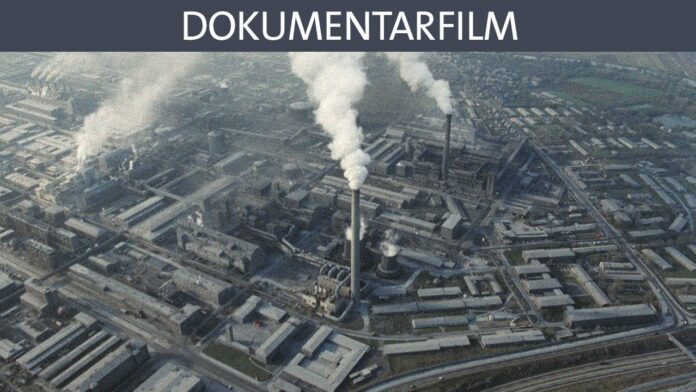Im Jahr 1978 befand sich die Hochseefischerei der DDR auf einem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Die Fischereiflotte der DDR, eine der leistungsfähigsten der sozialistischen Länder, spielte eine entscheidende Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung mit Fisch und Meeresfrüchten. Gleichzeitig war die Hochseefischerei ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und trug zur Devisenbeschaffung des Staates bei. Die DDR-Flotte war in nahezu allen Weltmeeren unterwegs, von der Nordsee bis zum Atlantik, von der Arktis bis zu den Küsten Afrikas und Südamerikas.
In den 1970er Jahren war Fisch ein unverzichtbarer Bestandteil der Lebensmittelversorgung der DDR. Neben der Binnenfischerei und dem Küstenfischfang stellte die Hochseefischerei die wichtigste Quelle für Fischprodukte dar. Besonders Kabeljau, Hering, Makrele und Rotbarsch waren beliebte Fische, die in den Haushalten der DDR auf den Tisch kamen. Die Hochseefischerei sicherte einen erheblichen Teil dieser Versorgung und war gleichzeitig ein Symbol für die Leistungsfähigkeit und den technischen Fortschritt der DDR. Die Fischereiflotte war modern ausgestattet. Schiffe wie die „Fritz Heckert“ oder die „Johannes R. Becher“ gehörten zu den Flaggschiffen der Flotte, die von Rostock und Saßnitz aus auf große Fangreisen aufbrachen. Die Flotte bestand aus Trawlern, Fabrikschiffen und Kühlfrachtern, die teilweise mehrere Monate auf See blieben und in den entlegensten Gebieten der Weltmeere operierten.
Die Arbeit an Bord der Fangflotte war hart, gefährlich und verlangte den Seeleuten viel ab. Die Besatzungen waren oft für Monate von ihren Familien getrennt und den extremen Wetterbedingungen sowie der rauen See ausgesetzt. Besonders in den nördlichen Fanggebieten, wie vor der Küste Grönlands oder in der Barentssee, konnten die klimatischen Verhältnisse brutal sein. Eis, Sturm und eiskalte Temperaturen machten das Einholen der Netze zu einer gefährlichen Aufgabe. Die Schichtarbeit an Bord war anstrengend und monoton. Die Seeleute arbeiteten in Zwölf-Stunden-Schichten, oft unter extremen Bedingungen. Während der Fangzeiten mussten große Netze ausgebracht, eingeholt und der Fang an Bord verarbeitet werden. Auf den Fabrikschiffen wurde der Fisch sofort nach dem Fang gesäubert, filetiert, verpackt und tiefgefroren. Diese harte Arbeit erforderte nicht nur körperliche Ausdauer, sondern auch technisches Geschick, um die komplexen Maschinen an Bord zu bedienen.
Trotz der extremen Bedingungen gab es unter den Seeleuten einen starken Zusammenhalt. Kameradschaft und Solidarität waren unverzichtbar, um die langen Zeiten auf See zu überstehen und die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Viele Fischer waren stolz auf ihre Arbeit und betrachteten die Hochseefischerei als eine wichtige Aufgabe für die Versorgung der Bevölkerung. Gleichzeitig gab es aber auch immer wieder Berichte über Unzufriedenheit, vor allem aufgrund der langen Trennung von den Familien und der harten körperlichen Arbeit.
Die Hochseefischerei war nicht nur für die Nahrungsmittelversorgung der DDR von Bedeutung, sondern spielte auch eine wichtige Rolle im außenwirtschaftlichen Kontext. Ein großer Teil des gefangenen Fisches wurde exportiert, vor allem in die Sowjetunion, aber auch in andere sozialistische Staaten und den Westen. Fisch war ein begehrtes Exportgut, das der DDR Devisen einbrachte, die dringend für den Import von Rohstoffen und anderen Waren benötigt wurden. In den 1970er Jahren führte die DDR eine expansive Wirtschaftspolitik, die darauf abzielte, die Devisenreserven durch den Export von Waren und Dienstleistungen zu steigern. Die Hochseefischerei trug dazu bei, indem sie nicht nur Fischprodukte lieferte, sondern auch durch den Betrieb der Fischereiflotte selbst Einnahmen generierte. Neben den Fangreisen gab es auch Kooperationen mit anderen Ländern, bei denen die DDR-Fangflotte gegen Entgelt Fischereirechte in ausländischen Gewässern erhielt.
Allerdings standen die DDR-Fischereibetriebe unter zunehmendem Druck, effizienter zu arbeiten und die Fangquoten zu erfüllen. Der internationale Wettbewerb, insbesondere durch westliche Fischereinationen wie Norwegen, Island und Großbritannien, stellte eine Herausforderung dar. Zudem wurden in den 1970er Jahren zunehmend internationale Fischereiverträge abgeschlossen, die den Zugang zu bestimmten Fanggebieten reglementierten oder stark einschränkten. So führte die Einführung von 200-Meilen-Wirtschaftszonen durch viele Küstenstaaten dazu, dass die DDR-Fischereiflotte den Zugang zu traditionellen Fanggründen verlor.
Das Leben an Bord eines Hochseefischereischiffes der DDR in den 1970er Jahren war hart, aber strukturiert. Die Besatzung bestand in der Regel aus etwa 30 bis 50 Männern, je nach Größe des Schiffes. Der Tagesablauf war streng durchorganisiert, um die Arbeitseinsätze effizient zu gestalten. Die Männer arbeiteten oft in zwei Schichten: zwölf Stunden Arbeit, zwölf Stunden Ruhe. Während der Arbeitsschicht wurde der Fischfang durchgeführt, die Netze eingeholt und der Fang verarbeitet. In der Ruhephase konnten sich die Seeleute ausruhen, obwohl die engen Kabinen und die oft rauen Seeverhältnisse keine wirkliche Erholung boten.
Auf den modernen Fabrikschiffen gab es zumindest einige Annehmlichkeiten. Die Besatzungen hatten Zugang zu Fernsehgeräten, Büchern und Sportgeräten, um die langen Monate auf See erträglicher zu machen. Zudem wurde an Bord für das leibliche Wohl gesorgt, denn eine ausgewogene Ernährung war für die harte Arbeit an Deck unerlässlich. Doch die Härte der Arbeit und die extremen Bedingungen prägten den Alltag auf See.
Im Jahr 1978 befand sich die Hochseefischerei der DDR in einer Phase des Umbruchs. Die zunehmenden Einschränkungen durch internationale Fischereirechte und der steigende Kostendruck machten deutlich, dass das Modell der Hochseefischerei in seiner bisherigen Form an Grenzen stieß. In den folgenden Jahren sollte sich diese Entwicklung weiter verschärfen, was letztlich zur schrittweisen Reduzierung der DDR-Fischereiflotte führte.
Doch im Jahr 1978 blickten die Fischer noch optimistisch in die Zukunft. Neue Technologien, wie verbesserte Fangmethoden und modernisierte Schiffe, sollten helfen, den Herausforderungen der Fischereiindustrie zu begegnen. Zudem hofften viele, dass die internationalen Verhandlungen über Fischereirechte der DDR weiterhin Zugang zu den wichtigsten Fanggebieten sichern würden. Die Hochseefischerei der DDR war ein prägender Wirtschaftszweig, der nicht nur zur Versorgung der Bevölkerung beitrug, sondern auch ein Symbol für den technischen Fortschritt und die Leistungsfähigkeit des Landes war. Doch hinter der Fassade der modernen Flotte verbarg sich der harte und oft gefährliche Alltag der Fischer, die auf den Weltmeeren unterwegs waren, um den Bedarf an Fisch zu decken.