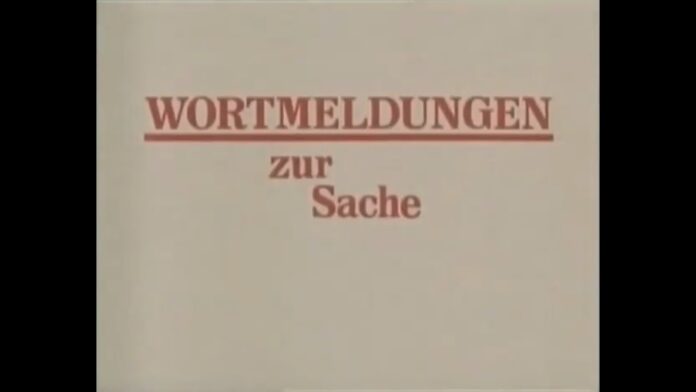Ein eindrucksvolles Zeugnis aus der DDR-Zeit zeichnet das Bild eines Mannes, der in den Schatten des faschistischen Regimes seinen bisherigen Glauben hinter sich ließ und sich dem Marxismus-Leninismus zuwandte. Der Vortrag, dessen Transkript aus dem NVA-Film von 1983 stammt, enthüllt nicht nur den persönlichen Transformationsprozess, sondern auch die Wechselwirkung zwischen Kriegserfahrungen, ideologischer Neuausrichtung und künstlerischem Schaffen.
Zwischen Theologie und politischer Überzeugung
Der Sprecher – einst als PK (geistlicher Stellvertreter) tätig – berichtet von den schweren Zeiten der 1930er und 1940er Jahre. Die erlebte Grausamkeit des Krieges und die unerfüllte Antwort der traditionellen christlichen Lehre führten ihn zu tiefen existenziellen Fragen. In einer Epoche, in der der Faschismus mit unvorstellbarer Brutalität über Deutschland herrschte, bot der alte Glaube keine Antworten auf die moralischen und gesellschaftlichen Verwerfungen, die der Krieg mit sich brachte.
Die Begegnungen mit prägenden Persönlichkeiten – etwa dem verstorbenen Odo Braun oder dem sowjetischen Genossen Rostov – weckten in ihm den Entschluss, die eigene Weltanschauung radikal zu überdenken. So entstand ein Wendepunkt: Aus dem Theologen wurde ein überzeugter Marxist, der den Übergang zur marxistisch-kommunistischen Ideologie als notwendigen Schritt zur Überwindung der alten, zerstörerischen Ordnungen ansah.
Kriegserlebnisse als Katalysator des Wandels
Die Kriegserfahrungen des Sprechers spielten eine zentrale Rolle bei der ideologischen Neuausrichtung. Als Soldat und später als Kriegsgefangener wurde er Zeuge der Schrecken und Widersprüche des militärischen Systems. Die Erkenntnis, dass der von faschistischen Mächten geführte Krieg ein reiner Raub- und Eroberungskrieg war, führte zu einer tiefgreifenden inneren Krise. Diese Phase der Selbstprüfung mündete in der bewussten Entscheidung, den alten Glauben zugunsten einer neuen, auf wissenschaftlichen und historischen Grundlagen beruhenden Weltanschauung aufzugeben – ein Schritt, der auch persönliche Opfer und den Bruch mit familiären Bindungen mit sich brachte.
Ideologische Neuausrichtung und gesellschaftliche Verantwortung
Der Sprecher betont, dass der Übergang zum Marxismus-Leninismus weit über einen rein intellektuellen Wechsel hinausgeht. Es handelt sich um eine umfassende Neuausrichtung der Persönlichkeit – eine Transformation, die alle Lebensbereiche durchdringt: Moral, Denken und künstlerisches Schaffen. Für ihn und viele seiner Zeitgenossen war es eine Frage der Überlebensstrategie in einer Welt, die von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt war.
Die Darstellung des Marxismus als Wegweiser zu einer gerechten und friedlichen Weltordnung spiegelt die Hoffnung und den Glauben an eine bessere Zukunft wider. Dabei wird auch die Rolle der Kunst hervorgehoben: Künstler wie der Maler und Grafiker Arnold Pemann trugen aktiv dazu bei, das gesellschaftliche Bewusstsein zu schärfen und den Menschen einen neuen Blick auf die Realität zu eröffnen. In diesem Zusammenhang wurde die Kunst als Medium verstanden, das nicht nur ästhetische Erfahrungen vermittelt, sondern auch als Instrument für politischen und gesellschaftlichen Wandel dient.
Militärische Disziplin und persönlicher Einsatz
Ein weiterer Abschnitt des Vortrags widmet sich den Erfahrungen in der militärischen Ausbildung. Der Sprecher schildert eindrucksvoll die Herausforderungen, die mit dem Erlernen strikter Disziplin und der Anpassung an das Leben als Soldat einhergingen. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten – sei es das Entgegennehmen von Befehlen oder das Verlassen des gewohnten häuslichen Umfelds – wurde die militärische Ausbildung als notwendiger Bestandteil der eigenen Entwicklung empfunden. Die kollektive Anstrengung und der Zusammenhalt in der Truppe verliehen diesem Prozess zusätzlichen Rückhalt und Bestätigung der getroffenen Entscheidung.
Die militärische Erfahrung, so betont er, sei nicht als reine Pflichtübung zu verstehen, sondern als Beitrag zur Verteidigung und zum Schutz der gesellschaftlichen Werte. Der Soldat zu sein, wurde als integraler Bestandteil der persönlichen Identität gesehen – ein Element, das nicht im Widerspruch zu den künstlerischen und intellektuellen Ambitionen stehen musste, sondern vielmehr eine harmonische Ergänzung im Kampf für Frieden und Gerechtigkeit darstellte.
Ein Leben im Dienst des Wandels
Der Vortrag schließt mit einem eindringlichen Appell: Die individuelle Transformation und das unermüdliche Streben nach einer besseren Weltordnung sind untrennbar mit der Verantwortung des Einzelnen verbunden. Für den Sprecher bedeutete die Abkehr von überlieferten Glaubenssätzen und die Hinwendung zu einer marxistisch-kommunistischen Ideologie nicht nur einen ideologischen Bruch, sondern auch den Beginn eines lebenslangen Lernprozesses. Diese Entwicklung ermöglichte es ihm, sich aktiv in den politischen und gesellschaftlichen Wandel einzubringen und damit einen Beitrag zur Erhaltung des Friedens und zur Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft zu leisten.
In einer Zeit, in der politische und gesellschaftliche Umbrüche allgegenwärtig waren, zeigt der Bericht eindrucksvoll, wie persönliche Erfahrungen und ideologische Überzeugungen untrennbar miteinander verbunden sind – und wie der Glaube an einen Wandel, unterstützt durch Disziplin, Kunst und politischen Einsatz, zur Basis für eine neue gesellschaftliche Ordnung werden kann.