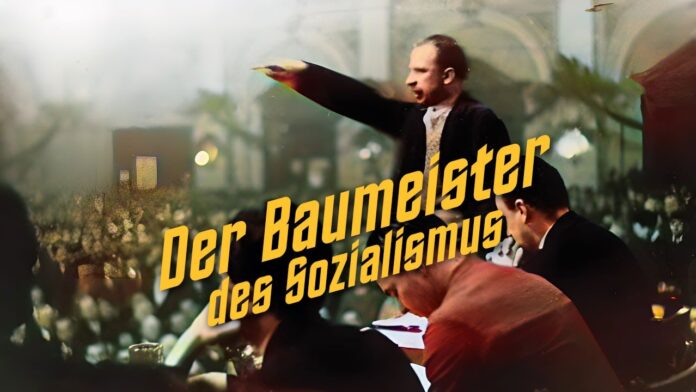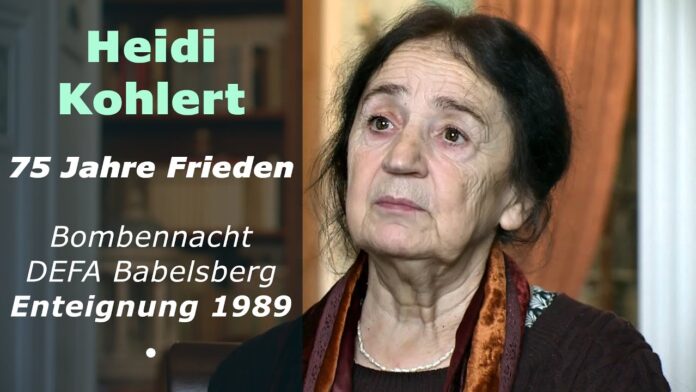Die Dokumentation „KDF – Koloss von Prora“ zeichnet den unglaublichen Werdegang eines monumentalen Bauprojekts nach, das von den Nationalsozialisten als Symbol für Arbeitsbeschaffungsprogramme und den modernen Erholungsort für deutsche Arbeiter geplant wurde. Das ursprünglich als Luxushotel konzipierte Seebad auf Rügen, das über 10.000 Zimmer und Platz für mehr als 20.000 Urlauber haben sollte, bot an allen Seiten einen unverbauten Blick auf die Ostsee. Unter der Leitung des Architekten Clemens Klotz und mit persönlichen Eingriffen Hitlers, der sogar eine Festhalle ergänzen ließ, entstand ein Großbauwerk, das exemplarisch für den monumentalen Bauruhm der NS-Zeit steht.
Bereits vor Baubeginn musste ein geeigneter Standort gefunden werden – der Küstenabschnitt nahe der Prora-Wieg auf Rügen war im Besitz des Adligen Malte von Putbus. Nach anfänglicher Zustimmung kam es schon bald zu Konflikten, als von Putbus sich gegen parteipolitische Forderungen und die Behandlung als „Judenfreund“ wehrte. Diese Auseinandersetzungen führten letztlich zu seiner Schreckensgeschichte: Von Putbus wurde 1945 im KZ Sachsenhausen unter mysteriösen Umständen getötet.
Bauphase und Kriegsnutzung (1936–1939):
Der Grundstein für den als „Koloss von Rügen“ bekannten Bau wurde am 2. Mai 1936 gelegt. Neun riesige Wohnblöcke, von denen jeder sechs Stockwerke hoch werden sollte, entstanden zügig – dabei waren über 9.000 Arbeiter im Einsatz und die Baukosten schossen von ursprünglich 50 Millionen Mark rasch auf über 237 Millionen Mark in die Höhe. Bereits 1937 wurde ein Modell des Projekts auf der Weltausstellung präsentiert, wobei das Vorhaben international Anerkennung fand. Doch 1939, mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wurde der Bau abrupt gestoppt.
Nutzung im Zweiten Weltkrieg (1939–1945):
Während des Krieges fand Prora vielfältige militärische und zivile Verwendung. Zwar blieben die unvollendeten Rohbau-Blöcke der späteren Wohnhäuser größtenteils unbewohnbar, dennoch diente ein Teil der Anlage als Ausbildungsstätte für Luftwaffenhelferinnen und als Standort eines Polizeibataillons. Im Jahr 1943 wurden zudem Teile des südlichen Blocks ausgebaut, um Ersatzquartiere für Hamburger zu schaffen, deren Wohnungen im Rahmen der Operation Gomorrha zerstört worden waren. Ab 1944 richtete die Wehrmacht in Prora ein kleines Lazarett ein, und gegen Ende des Krieges boten die unfertigen Wohnbereiche auch Flüchtlingen aus den Ostgebieten eine Notunterkunft.
Die Jahre nach Kriegsende (1945–1990):
Ab Mai 1945, als die Sowjetunion Rügen übernahm, wurde die Anlage zunächst für interne Zwecke genutzt. Großgrundbesitzer wurden interniert und Heimatvertriebene aus den Ostgebieten fanden hier Unterkunft. Gleichzeitig wurden Teile des Komplexes als Kriegsreparationen demontiert. Zwischen 1948 und 1953 nutzte die Rote Armee das Gelände intensiv – der südlichste Rohbau wurde sogar sprengungsbedingt abgetragen, und auch an den beiden nördlichsten Häuserblocks kam es zu massiven Sprengungen. Vom vorletzten Block blieb nur ein Segment stehen, während am letzten Block etwa die Hälfte erhalten blieb – ein Zustand, der teilweise noch heute an die unvollendeten Rohbauten erinnert, die später zur Kaserne umgebaut werden sollten. In dieser Zeit war auch die sowjetische 13. Panzerjäger-Brigade in Prora stationiert.
In den unmittelbaren Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde kontrovers über die künftige Nutzung des Komplexes diskutiert. Presseberichte forderten, angesichts der enormen Arbeitergelder – etwa 60 Millionen Mark – müsse das Bauwerk doch zu einem Erholungsort für die Werktätigen weiter ausgebaut werden. Diese Diskussionen standen im krassen Gegensatz zu den späteren militärischen Nutzungen, als in der DDR Umbaumaßnahmen vorgenommen wurden, um Prora als Kasernengelände und Ausbildungszentrum für die Nationale Volksarmee einzusetzen.
Nach der Wiedervereinigung – Der schmale Grat zwischen Denkmal und Neubeginn:
Mit dem Fall der Mauer 1990 änderte sich das Schicksal des Kolosses erneut. Zunächst übernahm die Bundeswehr Teile der Anlage, bevor das Bauwerk unter Denkmalschutz gestellt wurde, um als Mahnmal der NS-Zeit zu dienen. In den folgenden Jahren wurden einzelne Bereiche neu konzipiert: Ein Museum dokumentiert die bewegte Geschichte, ein Teil der Anlage diente als Jugendherberge – zeitweise sogar als größte Jugendherberge Europas – und andere Blöcke wurden in luxuriöse Wohnungen umgewandelt. Diverse Sanierungsprojekte, die den ursprünglichen Traum eines Luxushotels wiederbeleben sollten, scheiterten jedoch letztlich an wirtschaftlichen Schwierigkeiten – zuletzt meldete 2018 ein Sanierungsunternehmen Insolvenz an.
Die wechselvolle Geschichte der Prora reicht von den nationalsozialistischen Ambitionen über den pragmatischen Einsatz im Krieg und der harten Realität des Nachkriegs-Nutzens bis hin zu den Diskussionen und Projekten der Wiedervereinigung. Das Bauwerk bleibt ein eindrucksvolles, aber auch umstrittenes Zeugnis vergangener Zeiten, das immer wieder Fragen aufwirft – ob und wie sich die düstere Vergangenheit in eine lebensfähige Zukunft transformieren lässt.