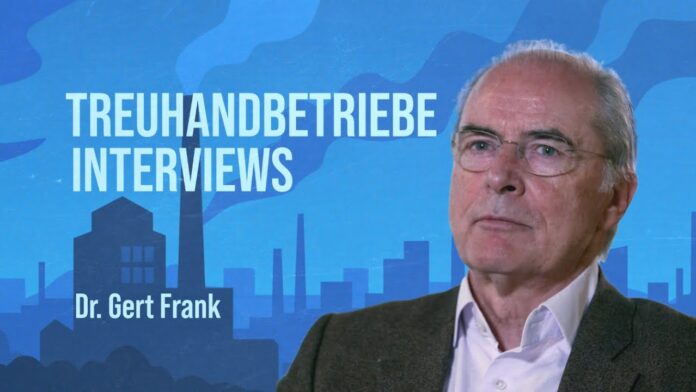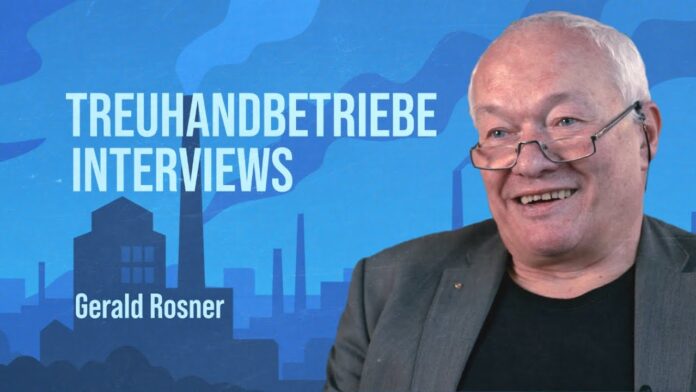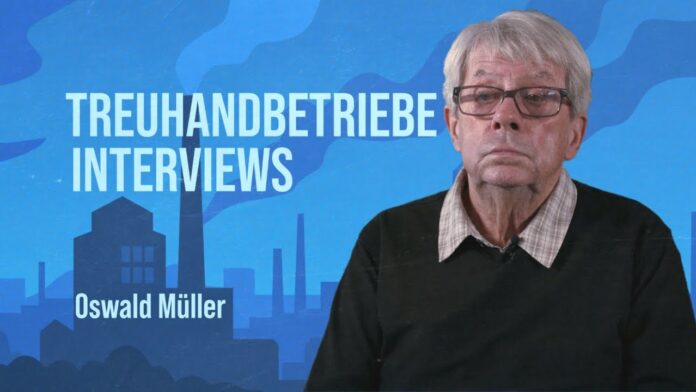Die frühen 1990er Jahre in Ostdeutschland waren eine Zeit des radikalen Umbruchs. Nach der Wiedervereinigung stand die Wirtschaft der ehemaligen DDR vor dem Nichts. Märkte brachen weg, es gab keine Anreize für Unternehmen und die Situation war oft chaotisch. Es gab kein Telefon, keine Verbindungen von Ost nach West, kein Eigentümer, kein Geld, keine Umsätze – einfach alles war chaotisch. Massenentlassungen waren die Folge, da Einnahmen fehlten und der Staat nicht unbegrenzt subventionieren konnte.
Inmitten dieses Chaos sahen einige Menschen eine Chance. Einer von ihnen war Dr. Gerd Frank, der Anfang 1992 die Investmentbank verließ, um sich selbstständig zu machen. Er suchte nach unternehmerischer Tätigkeit im Osten, wo er „viel zu tun gab“. Frank bezeichnete sich selbstironisch als „Schrottspezialist“, der sich um Dinge kümmerte, die andere liegen ließen, weil er kein Geld für „solche“ Übernahmen hatte. Diese zurückgelassenen Möglichkeiten waren für ihn die „unternehmerischen Nuggets“.
Seine Suche führte ihn zufällig zum Thermometerwerk Geraberg. Auf einer Raststätte in Thüringen las er in der Zeitung „Freies Wort“ von einem Unternehmen, das einen Quecksilber-Ersatzstoff erfunden hatte. Neugierig geworden, recherchierte er in einer Treuhand-Datenbank und fand heraus, dass das Werk „gesperrt“ war. Dies geschah im Zuge eines politischen Moments, der sogenannten „Bankenmilliarde“, bei dem Banken angehalten wurden, in Firmen zu investieren. Trotzdem bewarb sich Frank mit einem Fax. Ein Jahr später, im August 1993, kam überraschend die Einladung zur Privatisierung in Berlin.
Die Übernahme war ein immenses Risiko. Frank beschrieb sie als „binäres Investment“ – entweder würde alles den Bach runtergehen oder es würde gut werden. Er übernahm das Werk mit 220 Mitarbeitern. Um einen Bankkredit zu erhalten, musste er all sein Erspartes verpfänden und hinterlegen. Die Treuhand gab zwar etwas dazu, aber „der Schinken dauer[te] nicht ewig“, es musste schnell Erfolg erzielt werden. Frank bürgte für 8 Millionen D-Mark und zusätzlich für die Löhne der Mitarbeiter auf Jahre – ein Betrag, den er im Normalfall nicht hätte bezahlen können. Solche Verpflichtungen einzugehen, wäre im normalen Leben niemals denkbar gewesen, da das Risiko, dass die Firma scheitert, real war.
Um die Kredite bedienen zu können, arbeitete er Tag und Nacht. Die Abfindungen für Mitarbeiter mussten kalkuliert und bezahlt werden. Für rund ein Jahr gab es einen Zuschuss von der Treuhand von etwa 2 Millionen Euro. Eine weitere Herausforderung war der Umgang mit den Immobilien. Das Gelände und Gebäude in Geraberg waren der Treuhand zufolge Millionen wert (8-9 Millionen D-Mark). Frank brauchte aber das Gelände nicht, er brauchte Kapital. In einem ungewöhnlichen Tauschgeschäft gab er den Treuhandvertretern neun Millionen Wert (Grundstück) für drei Millionen, um das Geld sofort in den Bau einer neuen Fabrik zu investieren. Es stellte sich später heraus, dass das alte Gebäude verseucht war, was Franks ungewöhnliche Entscheidung im Nachhinein als glücklich erscheinen ließ.
Die anfängliche Zeit war eine Pionierphase. Die Mitarbeiter waren super und halfen enorm mit; niemand fragte nach 8-Stunden-Tagen, da sie sahen, dass auch Frank ständig präsent war. Trotzdem musste die Mitarbeiterzahl von 220 auf 80 reduziert werden, bevor sie allmählich wieder anstieg. Frank musste vertraglich garantieren, eine Mindestmitarbeiterzahl (z.B. 80 oder 100) für vier bis fünf Jahre zu halten und ein Investitionsvolumen (8 oder 5 Millionen) per Bürgschaft zu sichern. Er erreichte alle vertraglichen Ziele und musste keine Konventionalstrafen zahlen, was vielen anderen in dieser Zeit nicht gelang.
Die Beziehung zur Treuhand nach der Übernahme war nicht immer einfach. Neben dem Verkaufsteam gab es Revisionsteams, die versuchten, abgeschlossene Verträge zugunsten der Treuhand zu manipulieren. Zugesagte Gelder, etwa zur Deckung von Löhnen, wurden plötzlich von anderen Abteilungen verwaltet oder nicht ausgezahlt. Frank erlebte auch Drohungen und Druck, Mitarbeiter zu entlassen, was ihn ruinieren könnte, falls er die vereinbarten Mitarbeiterzahlen nicht halten konnte.
Das Unternehmen, ursprünglich „Thermometer Kombinat Erzmann 2“, wurde in Gerat Medical umbenannt. Der Fokus lag zunächst auf dem entwickelten Quecksilber-Ersatzstoff und der Herstellung von quecksilberfreien Fieberthermometern aus Glas. Obwohl zunächst viele dachten, das brauche niemand, wurde dies zur Rettung der Firma und zum „eigentlichen Turbo“. Frank holte sich sogar als Erster in Deutschland die Erlaubnis, das Greenpeace-Logo auf die Produkte zu drucken. Die Vermarktung im Westen war schwierig, also wandte er sich schnell dem Ausland zu und besuchte Messen in Dubai und Singapur.
Sukzessive stellte er alte Produkte wie technische Thermometer ein und konzentrierte sich auf Medizintechnik für Apotheken. Gegen den Widerstand der Mitarbeiter, die an Glas gewöhnt waren, führte er digitale Thermometer ein. Er baute die Marke Gerat Medical auf und erweiterte das Portfolio um andere Bereiche wie Vorhofflimmern-Diagnose und Lungenfunktionsmessung, um die Abhängigkeit von Glasthermometern zu verringern.
Intern gab es ebenfalls Konflikte und kulturelle Missverständnisse. Die meisten Unruheherde fand Frank in der alten Geschäftsführung, die selbst auf die Privatisierung gehofft hatte. Ein krasses Beispiel war der Geschäftsführer, der ohne Franks Wissen einen Leasingvertrag für eine Luxus-S-Klasse auf Firmenkosten abschließen wollte, während Frank jeden Cent sparte. Solche Vorfälle führten zu einem „Kultur-Clash hoch 3“. Nach weiteren „extremen Unregelmäßigkeiten“ entließ Frank den Geschäftsführer. Später verkaufte dieser das Firmenpatent an Chinesen, was rechtlich nicht zulässig war.
Trotz dieser Schwierigkeiten und der ständigen finanziellen Anspannung – Frank zog sieben Jahre lang kein Gehalt aus der Firma – blickt er positiv auf die Zeit zurück. Er vermisst diese Zeit nicht. Es war eine „tolle Zeit“, geprägt von Pioniergeist und der Zusammenarbeit mit vielen Menschen, die sich bemühten, etwas aufzubauen. Solche großen Transformationsprozesse, wie die Umgestaltung der DDR-Wirtschaft, erfordern Freiräume und eine Deregulierung, anstatt alles reglementieren zu wollen. Im Nachhinein gebe es immer „Besserwisser und Nörgler“, aber er habe nie das Gefühl gehabt, dass bei der Treuhand „Gangster“ oder „Schieber“ am Werk waren.
Heute ist Dr. Frank nicht mehr operativ tätig, sondern sitzt als Hauptaktionär im Aufsichtsrat der Firma, die es immer noch gibt. Die Erfahrung der Transformation und des Aufbaus aus dem Nichts bleibt für ihn eine wertvolle Lektion.