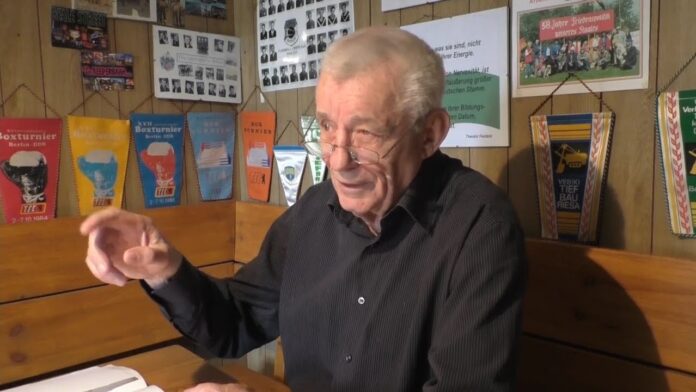Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag Deutschland in Trümmern. Die Siegermächte teilten das Land und die Hauptstadt Berlin in vier Besatzungszonen auf: Briten im Nordwesten, Amerikaner im Süden, Franzosen in Rheinland-Pfalz und Teilen Baden-Württembergs sowie die Sowjets im Osten. Auch Berlin wurde in Sektoren unterteilt, die jeweils von einer der Siegermächte besetzt und verwaltet wurden. Ursprünglich war geplant, Deutschland und Berlin gemeinsam zu regieren. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch.
Die Weichenstellung im Osten
Die Sowjets verfolgten das Ziel, Deutschland zu einem kommunistischen Staat zu machen. In ihrer Besatzungszone – dem Gebiet zwischen Oder und Thüringer Wald – gestatteten sie zunächst die Bildung unterschiedlicher Parteien wie KPD, SPD, CDU und LDPD. Diese Parteien waren jedoch im „antifaschistischen Block“ zusammengeschlossen, und die Besatzungsmacht versuchte mit allen Mitteln, eine Konkurrenz von Regierung und Opposition zu verhindern. Die Verwaltung der fünf Länder Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen wurde gleich nach dem Krieg bevorzugt mit Kommunisten besetzt.
Ein entscheidender Schritt zur Errichtung des sozialistischen Staates war die von der sowjetischen Besatzungsmacht erzwungene Vereinigung der KPD und der viel größeren SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) im April 1946. Dies geschah unter Drohungen gegen die SPD und Verhaftung widerstrebender Mitglieder. Ab 1948 gab es bei Wahlen nur noch gemeinsame Kandidatenlisten aller Parteien, freie Wahlen mit konkurrierenden Parteien fanden nicht mehr statt.
Die Gründung der DDR und die Einführung des Sozialismus
Während in Westdeutschland 1948 die Währungsreform durchgeführt und 1949 das Grundgesetz verkündet wurde, worauf die Bundesrepublik Deutschland entstand, konzentrierten sich die Sowjetunion und ihre deutschen Vertreter auf den Aufbau eines sozialistischen Staates in der Sowjetischen Besatzungszone. Am 7. Oktober 1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet. Deutschland war geteilt.
Der Aufbau des Sozialismus verlangte neben der politischen Herrschaft der Kommunisten vor allem die Sozialisierung der Wirtschaft. Die sowjetische Militärregierung führte 1946 eine sogenannte Bodenreform durch, bei der alle Grundbesitzer mit mehr als 100 Hektar enteignet wurden. Das Land erhielten Landarbeiter und Vertriebene, allerdings auf so kleinen Höfen, dass sie nicht existieren konnten – dies war beabsichtigt. Im zweiten Schritt wurden alle Bauernhöfe zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) zusammengeschlossen, wodurch der Sozialismus in der Landwirtschaft eingeführt war. Ähnlich wurden Banken und Industrie enteignet.
Nach der Theorie des Marxismus-Leninismus, auf die sich die Machthaber beriefen, sollte die Konzentration aller wirtschaftlichen Macht in der Hand der Arbeiterklasse zu einer Versorgung der Bevölkerung führen, die die westlich-kapitalistische in den Schatten stellte. Die Produktion und Güterversorgung wurde zentral geplant. Die sowjetische Besatzungszone verfügte über eine hochentwickelte Leichtindustrie (Feinmechanik, Optik, Textilindustrie), aber nur geringe Schwerindustrie und wenig Eisenerz und Steinkohle, obwohl Braunkohle, Kupfer und Kali reichlich vorhanden waren. Ohne die anderen Teile Deutschlands konnte die Zone nur unter erheblichen Mängeln produzieren und die Bevölkerung versorgen.
Herausforderungen des sozialistischen Wirtschaftsmodells
Trotz Bemühungen um den Aufbau einer Schwerindustrie und chemischen Industrie, was die Herstellung von Konsumgütern einschränkte, konnte die DDR die westdeutsche Wirtschaft nicht einholen. Im Jahr 1980 erreichte die DDR-Wirtschaft nur 20% der westdeutschen Produktion. Die Produktivität pro Beschäftigtem lag bei nur 56% des westdeutschen Niveaus. Sozialistisches Eigentum gab es als Volkseigentum (staatlich) und genossenschaftliches Eigentum, privaten Besitz nur noch im Einzelhandel, Handwerk und bei kleinen Gaststätten.
Die zentralistische Planwirtschaft traf oft nicht die Wünsche der Bevölkerung oder konnte diese nicht erfüllen, was häufig zu Mängeln in der Versorgung und der sogenannten „sozialistischen Warteschlange“ führte. Steigende Preise für Importe aus dem Westen in den 80er Jahren und nicht entsprechend steigende Gewinne für Ost-Produkte führten zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Nach der Wiedervereinigung zeigte sich, dass die DDR vor dem Konkurs stand und die Industrie überaltert war.
Auch die kollektivierte Landwirtschaft erwies sich als weniger produktiv als die westliche Privatwirtschaft, obwohl Facharbeiter wie Traktoristen und Melker ausgebildet wurden. Zudem nahm die DDR wenig Rücksicht auf den Umweltschutz; Flüsse, Grundwasser und die Ostsee wurden stark verschmutzt.
Staatliche Kontrolle und Überwachung
Der sozialistische Staat verstand sich als Machtinstrument der Arbeiterklasse und kannte weder Opposition noch Gewaltenteilung. An der Staatsspitze stand der Staatsrat (Vorsitzender bis 1989 Erich Honecker), die Regierung bildete der Ministerrat, der alle wesentlichen Fragen der Politik bestimmte. Die Entscheidungen der Regierung folgten den Weisungen des Politbüros der SED. Die Volkskammer, das Parlament, wählte formal die Minister und hatte das Recht Gesetze zu beschließen, doch Gesetze wurden faktisch vom Ministerrat eingebracht. Die fünf Länder wurden 1952 aufgelöst und die DDR in 15 Bezirke eingeteilt, die durch zentrale Weisungen des Ministerrats gesteuert wurden.
Zur Durchsetzung ihrer Herrschaft brauchten die Kommunisten unbegrenzten ideologischen Einfluss. Presse, Rundfunk, Fernsehen und Film wurden mit Parteigenossen besetzt. Westdeutsche Zeitungen waren im Osten nicht erhältlich, das Hören westlichen Rundfunks oder Sehen westlichen Fernsehens war in den 50er Jahren verboten und wurde mit Gefängnis bestraft. Nach dem Mauerbau tolerierte man westliche Informationen, da niemand mehr dem Sozialismus entfliehen konnte.
Vom Kindergarten an war der Bürger sozialistischer Erziehung ausgesetzt. In der Schule wurde zum sozialistischen Denken erzogen. An Universitäten musste neben dem Fach auch Marxismus-Leninismus und politische Ökonomie studiert werden. Kinder sollten in die Pionierorganisation Ernst Thälmann und Jugendliche in die FDJ eintreten. Kinder wurden früh mit Waffen vertraut gemacht, um sie zu Verteidigern des Sozialismus zu erziehen. Vormilitärische Ausbildung betrieb die Gesellschaft für Sport und Technik; eine Weigerung bedeutete Schwierigkeiten im Bildungsgang und in der Berufslaufbahn. Die politische Einbindung des Menschen in der DDR war total.
Ein Instrument des Klassenkampfes war nach marxistischer Ideologie auch die Justiz, die dem Grundsatz folgte: „Recht ist, was der Klasse nützt“. Die SED bildete klassenbewusste Richter aus. Der Staat nutzte die Volkspolizei (ein Polizist auf 170 Bürger, verglichen mit einem auf 329 in Westdeutschland), um die Bürger zu überwachen.
Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) festigte die Macht und bekämpfte die „Feinde des Sozialismus“. Das MfS hatte 1983 83.000 hauptamtliche und 173.000 informelle Mitarbeiter – Kollegen bespitzelten Kollegen, Kirchenmitglieder Pfarrer, Freunde Freunde. Konzentrationslager wie Sachsenhausen und Haftanstalten wie Bautzen waren Instrumente des Klassenkampfes. Weit über 100.000 Menschen kamen durch die Kommunisten in Konzentrationslagern und Gefängnissen ums Leben.
Alltag zwischen Mangel und Nischen
Jeder Bewohner der DDR erhielt einen Arbeitsplatz, doch der Staat bestimmte den Arbeitsbereich. Lohnkosten spielten in der Planwirtschaft keine Rolle. Der Lebensstandard zeigte sich in der Arbeitszeit, die für Konsumgüter nötig war. Während Grundnahrungsmittel stark subventioniert und billig waren (Roggenbrot kostete den Leipziger 6 Minuten Arbeitszeit, den Kölner 13 Minuten), waren importierte Waren oder als Luxus geltende Güter extrem teuer. Für 250g Bohnenkaffee arbeitete ein Leipziger 4 Stunden 20 Minuten, ein Kölner 24 Minuten. Ein Auto kostete einen Leipziger mehr als sechsmal so viel Arbeitszeit wie einen Kölner.
Dienstleistungen und Mieten waren hingegen sehr günstig. Die Kaltmiete einer Zweizimmerwohnung kostete einen DDR-Bewohner nur 14 Stunden 25 Minuten Arbeitszeit, einen Westdeutschen fast das Doppelte. Allerdings waren die Wohnungen im Westen deutlich besser ausgestattet; die niedrigen Mieten brachten keine Mittel für Reparaturen oder Modernisierungen ein. 1983 hatte ein DDR-Einwohner 25 qm Wohnfläche zur Verfügung, ein Westdeutscher 34 qm. Nur 36% der Wohnungen hatten Zentralheizung, 68% Bad oder Dusche, 60% Toilette in der Wohnung. Telefon galt als Luxus (22 von 100 Haushalten in der DDR, 89 im Westen). Autos waren selten (42 von 100 Haushalten in der DDR, 78 im Westen), dafür gab es viele Motorräder.
Die Gesundheitsfürsorge war unentgeltlich. Der Staat verlangte etwa 10% des Lohnes für Gesundheits-, Sozial- und Altersfürsorge, was aber nur die Hälfte der Ausgaben deckte. Trotz Fürsorgemaßnahmen war die umfassende Kontrolle allgegenwärtig. Auf 200 Einwohner kam ein hauptamtlicher MfS-Mitarbeiter, auf 96 Einwohner ein informeller. Der Bürger war fortwährender politischer Propaganda ausgesetzt.
Die größten geschützten Freiräume vor staatlicher Überwachung boten Ehe und Familie. Partnerschaftliche Beziehungen galten als Nischen der Eigenständigkeit. Die Berufstätigkeit beider Ehepartner war üblich und durch die geringen Löhne notwendig. Daher war die DDR reichlich mit Kinderkrippen und Kindergärten ausgestattet, die auch der sozialistischen Erziehung dienten. Die Erwerbstätigkeit der Frauen führte jedoch zu einem Geburtenrückgang, dem der Staat mit Hilfen entgegenzuwirken suchte. Trotzdem wurden zu wenig zweite und dritte Kinder geboren, und die Bevölkerungszahl sank.
Auch der Lebensabend alter Menschen gestaltete sich schwierig. Rentner machten einen erheblichen Teil der Bevölkerung aus (17,3% 1982), was die Staatskasse belastete. Renten waren entsprechend gering (41% des Einkommens eines Berufstätigen im Osten vs. 69% im Westen).
Die Wohnung war für Menschen jeden Alters der geschützte Freiraum, wo man das staatlich unerwünschte, aber beliebte Westfernsehen genießen konnte, das die im Osten fehlenden Güter zeigte. Neben Fernsehen waren Arbeit im Garten oder Fahrten zu gemieteten Grundstücken (Datscha) beliebte Freizeitbeschäftigungen. Staatlich erlaubtes Freizeitprogramm war oft politisch gefärbt. Auch der Urlaub stand unter staatlicher Fürsorge des FDGB, meist in betriebseigenen Urlaubsheimen im Inland. Begehrte, aber seltene Reisen führten ins sozialistische Ausland. Reisen ins westliche Ausland waren durch Stacheldraht und Minen entlang der Grenze verboten.
Kultur und Spitzensport
Die Kultur galt nach marxistischer Lehre als „Überbau“ des „wirtschaftlich-politischen Unterbaus“ und sollte stets das Klasseninteresse und den politischen Willen widerspiegeln. Die SED beanspruchte die führende Rolle und beaufsichtigte das Schaffen der Künstler; wer sich nicht fügte, wurde verfolgt, wer sich anpasste, erhielt ein Gehalt. Kulturelles Erbe wurde der Ideologie angepasst.
Während die DDR in Kultur, Wirtschaft und Lebensstandard nicht mit dem Westen mithalten konnte, erlangte sie im Spitzensport überragende Erfolge. Die SED setzte alles daran, auf diesem Feld die Überlegenheit des Systems zu beweisen. Wichtigste Mittel waren frühzeitige Talentsuche, staatliche Förderung, spezielle Sportschulen und der bedenkenlose Einsatz von Doping, auch männliche Hormone bei Sportlerinnen. Die DDR übertraf Westdeutschland bei Olympischen Spielen deutlich.
Der langsame Zerfall und das Ende
Weder die Einschränkungen demokratischer Freiheiten noch die Mängel in der Versorgung nahm die Bevölkerung der DDR ruhig hin. Ein Aufstand im Ost-Berlin am 17. Juni 1953 weitete sich auf die gesamte DDR aus und musste von sowjetischen Panzern unterdrückt werden. Eine massive Fluchtbewegung nach Westdeutschland setzte ein; bis 1961 flohen über drei Millionen Menschen. Aus Furcht vor dem „Ausbluten“ baute die DDR am 13. August 1961 eine Mauer um Westberlin und zog Stacheldraht quer durch Deutschland. Der kommunistische Zwangsstaat konnte sich nur behaupten, indem er seine Staatsbürger einsperrte.
Im Mutterland des Sozialismus, der Sowjetunion, hatten mit Gorbatschows Reformen bereits die Abkehr von Marx, Engels und Lenin begonnen. Es wurde allen klar, die ihn erlebt hatten, dass der Sozialismus versagt hatte. In der DDR bildeten sich ab 1989 Gruppen in den Kirchen, die Menschenrechte, Umweltschutz und Friedenspolitik diskutierten und demokratische Reformen forderten. Erich Honecker feierte noch den 40. Jahrestag der DDR, doch die Mauer bröckelte.
Das Schicksal der DDR vollzog sich rasch. Als Ungarn am 11. September 1989 begann, den Grenzzaun nach Österreich zu durchschneiden, setzte eine Reisewelle von DDR-Bürgern ein. Tausende gelangten über Österreich in die Bundesrepublik. Nach einem Reiseverbot nach Ungarn, Polen und Tschechoslowakei stürmten DDR-Bürger die bundesdeutschen Botschaften in Warschau und Prag.
Der Druck der Bevölkerung nahm gewaltig zu. Demonstrationen wurden anfangs noch gewaltsam aufgelöst. Doch am 9. Oktober demonstrierten 70.000 Menschen in Leipzig, am 16. Oktober schon 120.000. Die Regierung musste handeln; Honecker, der den Einsatz von Panzern gefordert hatte, wurde am 18. Oktober ersetzt. Die Armee weigerte sich, gegen Landsleute vorzugehen.
Die Menschen forderten nicht nur Honeckers Abgang, sondern das Ende des gesamten Sozialismus. Die Demonstrationen rissen nicht ab. Am 23. Oktober demonstrierten 300.000 in Leipzig für freie Wahlen. Als am 3. November eine halbe Million Menschen in Berlin das Ende der Alleinherrschaft der SED forderten, wusste die Regierung, dass die Stunde für ihren Sozialismus geschlagen hatte.
Am 9. November öffneten sie die Mauer und die innerdeutsche Grenze. Tausende Ostdeutsche strömten in den Westen. In der DDR bildeten sich Oppositionsgruppen und eine sozialdemokratische Partei wurde wiedererrichtet. Am 18. März 1990 wählte die Bevölkerung der DDR erstmals ein demokratisches Parlament.
Die Sowjetunion stellte sich einer Wiedervereinigung nicht mehr entgegen. In den 2+4-Verhandlungen stimmten die vier Siegermächte dem Zusammenschluss Deutschlands zu. Zwischen DDR und Bundesrepublik wurde eine Währungsunion beschlossen und am 1. Juli 1990 die D-Mark in der DDR eingeführt. Die Läden füllten sich mit westlichen Waren. Im August 1990 stimmte die frei gewählte Volkskammer für den Beitritt zur Bundesrepublik. Die Symbole des Kommunismus wurden beseitigt – er hatte sich ad absurdum geführt.
Am 3. Oktober 1990 war ein souveränes Deutschland wiedervereinigt. Eine der leidvollsten Epochen der deutschen Geschichte war zu Ende.