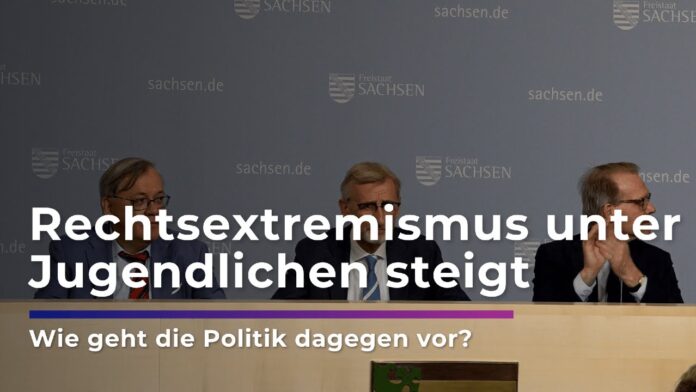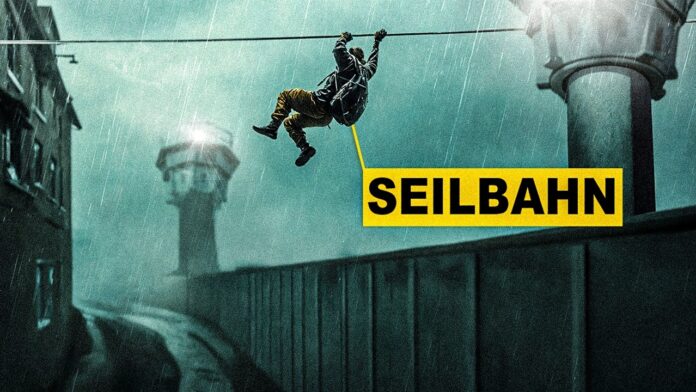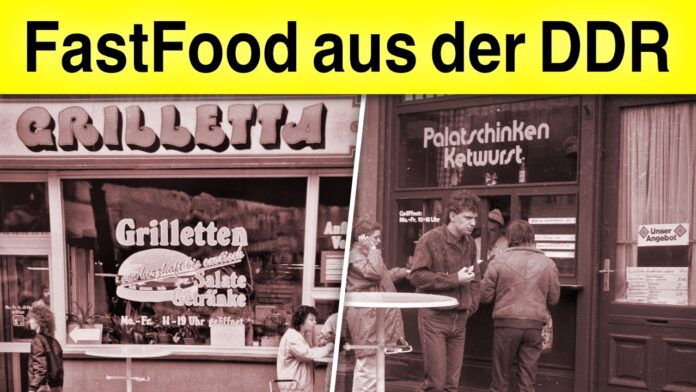Das Stasi-Unterlagen-Archiv, offiziell bekannt als Archiv des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU), hat mit seinem Podcast „111 km Akten“ eine Plattform geschaffen, um die Geschichte der Staatssicherheit und des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) aufzubereiten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Der Podcast wird von Maximilian Schönherr, einem Journalisten vor allem für den Deutschlandfunk und Erfinder des Archivradios, und Dagmar Hovestädt, der Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, moderiert. Ihre unterschiedlichen Ausgangspositionen – Schönherr als Externer mit großem Interesse und Kompetenz in Sachen Archiv, Hovestädt als interne Kennerin – ermöglichen einen kreativen Austausch und eine ausgewogene Betrachtung der Themen.
Das Format des Podcasts ermöglicht es, Experten zu Wort kommen zu lassen, wichtige Bücher zur Geschichte der Staatssicherheit zu beleuchten und O-Töne einzubauen. Ein Thema, das laut den Moderatoren besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit über Generationen hinweg. Der Podcast behandelt nicht nur die historische Perspektive, die 30 bis über 70 Jahre zurückliegt, sondern zeigt auch, wie diese Vergangenheit Menschen bis heute beschäftigt.
Ein eindrückliches Beispiel hierfür ist das Gespräch mit Annep Pfautsch, die über DDR-Fotografie promoviert und Gender Studies in England studiert. In Halle aufgewachsen, möchte sie die Akte ihres Vaters lesen, was im Generationendialog nicht immer auf Gegenliebe stößt. Während die jüngere Generation Klarheit sucht, scheint es bei manchen der älteren Generation, die in der DDR aufgewachsen ist, eine Tendenz zu geben, „alles ruhen [zu] lassen“ und „unter den Teppich [zu] kehren“, damit „bloß kein Staub aufgewirbelt wird“.
Diese Erfahrung wird durch eine weitere Anekdote unterstrichen, die in den Podcast eingebunden wurde. Eine Enkelin berichtet von ihrer Großmutter, die in der DDR lebte und offensichtlich noch immer Sympathie für das System, die SED und den Sozialismus von damals hegt. Auf die Frage, wohin die Enkelin unterwegs sei (zum Thema „30 Jahre Sicherung der Stasiunterlagen“), antwortete die Großmutter: „Also wenn du mich fragst das war damals der Mob“. Obwohl das persönliche Verhältnis ansonsten bestens ist, wird deutlich: Über politische Fragen, die die DDR betreffen, wird lieber nicht gesprochen, um Konflikte zu vermeiden – ein „vermientes Gebiet“ am Frühstückstisch oder der Geburtstagstafel. Dies verdeutlicht die Unsicherheit im Umgang mit der Vergangenheit und die Frage, wie man sich dazu verhalten kann, ohne Vorwürfen ausgesetzt zu sein.
Trotz der Herausforderungen der Generationendialoge zeigt der Podcast die breite Rezeption der Arbeit des Archivs. Der Podcast „111 km Akten“ wird über die eigene Webseite bstsu.de/podcast verbreitet, wo auch Kontextinformationen, Links, Transkripte und Fotos verfügbar sind. Zusätzlich wird er automatisiert über Podcast-Anbieter wie iTunes, Google Podcast und Spotify verbreitet. Dank der Daten von Spotify ist bekannt, dass der Podcast in insgesamt 25 Ländern international gehört wird. Während ein Schwergewicht erwartungsgemäß in Deutschland, der Schweiz und Österreich liegt (da der Podcast auf Deutsch ist), gibt es auch Hörer in anderen Teilen der Welt, wie eine Rückmeldung von einer australischen Deutschlehrerin zeigt. Diese globale Reichweite, ermöglicht durch die Plattform Podcast, wird als „toll“ und „faszinierend“ empfunden.
Die Macher des Podcasts äußern sich zufrieden mit ihrer Arbeit. Maximilian Schönherr beschreibt das Archiv als „fantastisches Archiv“ und ist nach einem Jahr Arbeit daran noch immer angetan: „je näher ich es kennenlerne (…) desto toller wird es“. Die Kommunikationsaufgabe des Archivs, die auch für Dagmar Hovestädt als ehemalige Journalistin nah am journalistischen Beruf liegt, besteht darin, aufzuklären, zu verstehen, Quellen in Beziehung zu setzen und zu erzählen, was damals war und was es heute noch bedeutet.
Ein wichtiges Thema für die Zukunft des Archivs, das auch im Podcast behandelt wird, ist die bevorstehende Integration des Stasi-Unterlagen-Archivs ins Bundesarchiv im Jahr 2021. Dies wird voraussichtlich der erste Podcast im neuen Jahr sein.
Die Produktion des Podcasts selbst musste sich den Coronazeiten anpassen. Statt in einem Raum mit Mischpult aufzunehmen, wird der Podcast getrennt aufgezeichnet, beispielsweise Maximilian Schönherr aus Köln und Dagmar Hovestädt aus Berlin, was jedoch inzwischen sehr routiniert abläuft.
Insgesamt bietet der Podcast „111 km Akten“ nicht nur Einblicke in die historischen Akten und die Arbeit des Stasi-Unterlagen-Archivs, sondern beleuchtet auch die komplexen und oft schwierigen Auswirkungen der DDR-Vergangenheit auf die heutigen Generationen und erreicht dabei ein weltweites Publikum.