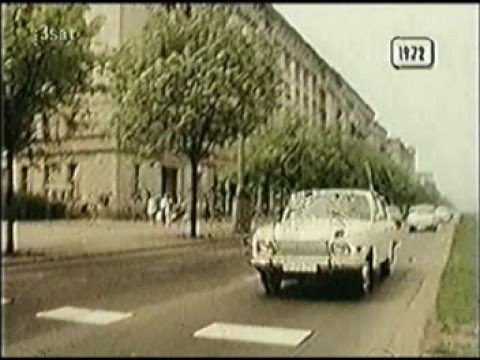Rostock, Deutschland – Der Rostocker Überseehafen feierte im April 2021 sein 60-jähriges Bestehen. Am 30. April 1961 wurde der Hafen feierlich eingeweiht. Als erstes Schiff legte damals der große Frachter MS Schwerin an. Heute ist der Hafen Rostock der viertgrößte deutsche Seehafen und der größte an der deutschen Ostseeküste.
Die Geschichte des Hafens an der Warnow reicht jedoch viel weiter zurück. Bereits vor der offiziellen Stadtgründung Rostocks im Jahr 1218 existierte hier ein kleiner Hafen, der von Händlern aus Skandinavien und Deutschland als Umschlagplatz genutzt wurde. Dieser Hafen wuchs über die Jahrhunderte, genügte aber Anfang der 1970er Jahre den Anforderungen nicht mehr. Obwohl der alte Warnow-Hafen nach dem Zweiten Weltkrieg und Anfang der 1950er Jahre wiederbelebt wurde, machten der stark zunehmende Außenhandel der DDR und die schnell wachsende Handelsflotte der Deutschen Seereederei (DSR) deutlich, dass die bestehenden Häfen in Wismar, Stralsund und Rostock diese neuen Anforderungen nicht mehr erfüllen konnten.
Dies führte im Oktober 1957 zum Beschluss des SED-Zentralkomitees, im Siebenjahrplan einen neuen, leistungsfähigen Seehafen zu bauen. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich die endgültige Teilung Deutschlands bereits ab. Als Standort wurde das alte, abgelegene Petersdorf am Breitling ausgewählt, rund zehn Kilometer vom Rostocker Stadtzentrum entfernt. Der erste Spatenstich erfolgte nur wenige Tage später, am 26. Oktober 1957, durch den damaligen Oberbürgermeister Solisch. Es entstand eine der größten Baustellen der Republik. Das Dorf Petersdorf, das nur aus wenigen Häusern bestand, wurde abgerissen, die Bewohner entschädigt und umgesiedelt. Eine landesweite Euphorie zum Aufbau des Hafens erfasste die DDR: Pioniere und FDJ sammelten 65.000 Tonnen Feldsteine, es gab 90 Millionen Mark Spenden und Hunderttausende unbezahlte Arbeitsstunden von Freiwilligen aus dem ganzen Land beschleunigten den Bau.
Nach nur zweieinhalb Jahren Bauzeit lief am 15. Januar 1960 das Fahrgastschiff „Völkerfreundschaft“ als erstes Schiff den neuen Hafen an. Am 30. April 1960 wurde der erste Bauabschnitt offiziell eingeweiht, und der Umschlagbetrieb begann. Mit der Entladung der MS Schwerin am Liegeplatz 31 im Hafenbecken B wurde Rostock für die DDR zum „Tor der Welt“. Anfangs gab es jedoch erhebliche Anlaufschwierigkeiten und Verstöße gegen Gesetze, was zur Absetzung des ersten Hafendirektors Wolfgang Benedikt führte. Die Probleme blieben zunächst bestehen.
Zehn Tage nach der Schwerin legte ein Frachter aus der ehemaligen Sowjetunion als erster ausländischer Frachter an. Der neue Hafen wurde zum Heimathafen der DSR-Schiffe. Betrieben wurde er vom VVB Seehafen Rostock. Zwischen 1960 und 1970 wuchs der jährliche Umschlag von einer Million auf 10 Millionen Tonnen. Bis zum 10. Hafengeburtstag 1970 wurden 16.000 Schiffe mit 50 Millionen Tonnen Ladung abgefertigt. Dank moderner Umschlagtechnik (über 50 Portalkräne und Kranbrücken) und der geringen Entfernung zur offenen See (0,7 Kilometer) erwarb sich der Hafen das Prädikat eines „schnellen Hafens“. In der Folgezeit wurde er zu einem effizienten Universalhafen ausgebaut.
Ab 1968 begann nach Anlaufproblemen der Containerverkehr am Kai 4. Auch der RoRo-Verkehr nahm zu. 1969 wurde eine Ölpipeline nach Schwedt in Betrieb genommen, die vom Ölhafen ausging. Der Apatit-Umschlag war in den 60ern eine markante Aufgabe, ebenso wie der Umschlag von Erz und Kohle. Zwischen 1957 und 1970 wurden rund 700 Millionen Mark im Hafen investiert. Mitte der 1970er Jahre entstanden spezielle Liegeplätze für Container- und RoRo-Schiffe. Der Umschlag stieg zwischen 1975 und 1980 von 12 auf 15 Millionen Tonnen jährlich.
In den 1980er Jahren wurde der Hafen weiter ausgebaut, unter anderem mit einem neuen Getreidehafen und einem Düngemittelkai. Der Warnow-Kai wurde für den Massenimport sowjetischer Metalle und den Export von Metallen und Fahrzeugen verlagert und ausgebaut. Ab Ende der 80er verfügte der Hafen über 36 Schiffsanlegeplätze. Über 40 % des Umschlags entfielen auf den Warenaustausch mit der Sowjetunion. Die wirtschaftliche Lage der DDR spiegelte sich im Hafen wider: Je schlechter die DDR-Wirtschaft lief, desto besser lief es im Hafen durch steigende Exporte zur Stützung der Wirtschaft. 1989 wurde mit 20,7 Millionen Tonnen das höchste Umschlagergebnis seit 1960 erreicht.
Parallel zum Hafenausbau wurde der Hafenbahnhof ständig erweitert und zu einem der größten Rangierbahnhöfe der DDR ausgebaut. 95 Prozent des Umschlags 1989 wurden per Bahn transportiert. Die Hafenbahn, die 1961 ihren Betrieb aufnahm, entwickelte sich zu einer wichtigen Dienststelle der Deutschen Reichsbahn. 1987 betrug die Gleislänge 240 Kilometer. Anfänglich wurden Dampflokomotiven eingesetzt, bald aber moderne Diesel-Lokomotiven. 1969 kam der erste Kühlcontainerzug über die Gleise des Fischereihafens an. Die Hafenbahn verlor Ende 1981/82 ihre Eigenständigkeit und wurde der Reichsbahndirektion Schwerin unterstellt. Ende 1985 erfolgte der Anschluss an das elektrische Bahnnetz. Bis zur Wende wurden über 90 Prozent der Trockengüter per Schiene transportiert.
Nach der Wende kam es 1991 zu einem Umschlagseinbruch von über 60 Prozent im Vergleich zu 1989. Nur noch 8,1 Millionen Tonnen wurden umgeschlagen. 1994 verließen sowjetische Truppen über den Überseehafen Deutschland. Die Hafenbahn stellte sich auf die neuen Bedingungen ein und ist heute ein unverzichtbarer Partner.
Seitdem hat der Seehafen Rostock wieder an seine besten Zeiten anknüpfen und die Ergebnisse übertreffen können. Er wurde erneut zu einem effizienten Universalhafen ausgebaut. Er bietet ein breites Leistungsspektrum, darunter moderne Anlagen für Öl, Chemikalien, Getreide, Düngemittel, Kohle, Zement und Stückgüter. Kein anderer deutscher Ostseehafen bietet ein so breites Spektrum. Rostock zählt heute zu den wichtigsten und umschlagstärksten Häfen der südlichen Ostsee.
Wichtig ist insbesondere der Fährterminal mit Verbindungen nach Dänemark, Schweden, Finnland und Polen. Sehr gut ausgebaute Hinterlandverbindungen per Straße und Schiene sichern den Transport. Der Hafen ist optimal an europäische Wirtschafts- und Logistikzentren angebunden. Bereits 2011 konnte mit 22,2 Millionen Tonnen der Rekord aus der Vorwendezeit übertroffen werden.
Betreiber des Seehafens ist heute die Rostock Port GmbH, deren Gesellschafter die Hansestadt Rostock und Mecklenburg-Vorpommern sind. Der Hafenbetreiber schätzt die vom Hafen abhängigen Arbeitsplätze auf rund 13.000. Über 150 Unternehmen, darunter Kranbauer Liebherr, sind auf dem über 750 Hektar großen Gelände angesiedelt. Zum Hafen Rostock gehören heute neben den bekannten vier Hafenbecken auch der Chemiehafen (Yara International) und der Kreuzfahrtterminal in Warnemünde. Der Warnemünder Terminal wird erweitert und modernisiert und zählt zu den beliebtesten deutschen Häfen für große Kreuzfahrtschiffe.
In den vergangenen Jahren, seitdem die Rekorde übertroffen wurden, hat der Hafen durch zielgerichtete Investitionen und die Unterstützung der Gesellschafter gepunktet. Auch die Initiativen privater Unternehmen trugen bei. Es entwickelte sich ein Universalhafen mit einem ausgewogenen Produktportfolio aus Fährverkehr, trockenen und flüssigen Massengütern sowie einem starken Stückgutbereich. Dieses Geschäftsmodell stützt sich auf mehrere Säulen, was Stabilität bietet. Der Fährverkehr dominiert stark und war über 25 Jahre ein Hauptwachstumstreiber. Beeindruckend ist die Entwicklung im Getreidesektor: Rostock hat sich von einem Importhafen zum größten Getreideexporteur Deutschlands entwickelt. Von großer Bedeutung ist auch der Stückgutumschlag der angesiedelten Industrieunternehmen wie Liebherr und Nordex, die zur Reindustrialisierung Rostocks beigetragen haben. Diese Unternehmen bringen zwar nicht immer die größten Umschlagmengen, aber erhebliche Wertschöpfung und Beschäftigung.
Auch der Ölhafen von Rostock Port genießt einen guten Ruf. Der Hafen ist tief mit der Lebensgeschichte mehrerer Generationen von Rostockern verbunden und steht für Aufbau, Erfolge, Rückschläge, Vertrauen und Zuversicht. Dies schafft eine starke Identifikation mit dem Hafen.
Die Corona-Pandemie stellte auch den Rostocker Hafen vor Herausforderungen. Geplante Feiern zum 60. Geburtstag mussten abgesagt werden. Es gab massive Einschränkungen, insbesondere im Kreuzfahrt- und Fährverkehr, die vollständig zum Erliegen kamen. Die Herausforderung besteht darin, den Gesundheitsschutz zu gewährleisten und gleichzeitig den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das breite Produktportfolio hilft, Krisenzeiten zu überstehen, da andere Bereiche versuchen, die Ausfälle auszugleichen.
Für die Zukunft plant der Hafen, das ausgewogene Geschäftsmodell zu erhalten, zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Eine mögliche neue Säule könnten synthetische Kraftstoffe sein, die im Hafen hergestellt, gelagert und umgeschlagen werden könnten. Die anstehende Seekanalvertiefung wird ebenfalls neue Möglichkeiten eröffnen. Eine Hauptaufgabe ist die Erhaltung und Anpassung der teils 60 Jahre alten Infrastruktur an neue Anforderungen, wie größere Schiffe. Angesichts knapper Flächen sind auch deren intensivere und alternative Nutzung sowie die Erschließung neuer Ansiedlungsflächen wichtige Themen. Das langfristige Ziel ist, dass auch in 60 Jahren, im Jahr 2080, Umschlag auf sicheren Liegeplätzen stattfindet.
Mit großem Optimismus blickt der Hafenbetreiber auf die kommenden Jahre und ist zuversichtlich, auch die aktuelle Krise zu überstehen.