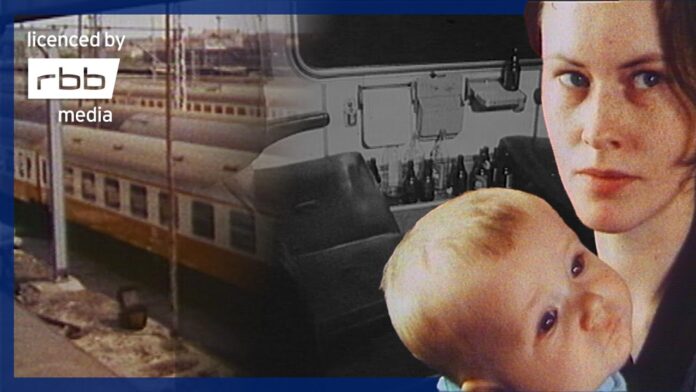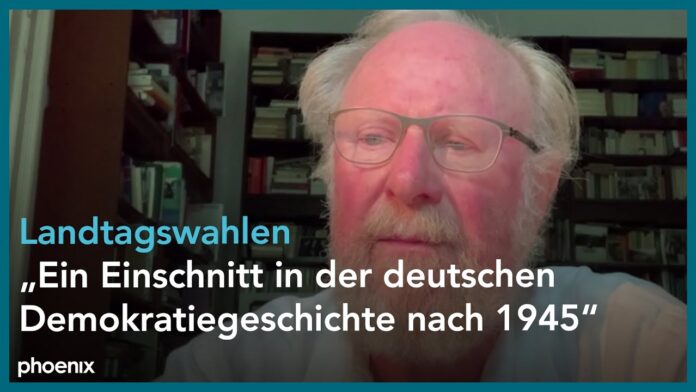AfD-Politiker fordern ein Ende des sogenannten „Schuldkults“ oder wie Björn Höcke einen radikalen Bruch in der Erinnerungskultur. Was bedeutet das für die Arbeit von KZ –Gedenkstätten wie Buchenwald und Mittelbau-Dora? Wie groß ist der Druck der AfD Thüringen auf den Direktor der Gedenkstätten? Wie die AfD mit der Erinnerung an Nationalsozialismus und DDR umgeht.
Jens-Christian Wagner, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, beschreibt die Bedeutung der KZ-Gedenkstätten für das Erinnern an die NS-Verbrechen. Er zeigt das Gelände der Gedenkstätte Buchenwald, darunter den Lagerzoo der SS, der sich in Sichtweite des Krematoriums befand, und veranschaulicht so die Grausamkeit des NS-Regimes. Wagner ist besorgt über einen „erinnerungspolitischen Klimawandel“, der durch das Erstarken der AfD vorangetrieben wird. Er beobachtet eine Zunahme von Geschichtsrevisionismus und Anfeindungen, insbesondere in Form von Hass-E-Mails und provokativen Kommentaren auf Social Media.
Die AfD kritisiert die Arbeit der Gedenkstätten, bezeichnet sie als „Schuldkult“ und stellt geschichtsrevisionistische Positionen in den Vordergrund. Wagner äußert seine Sorge, dass die AfD die Arbeit der Gedenkstätten und die deutsche Erinnerungskultur generell frontal angreift. Er sieht in den parlamentarischen Anfragen der AfD, wie die nach Auflistung von Politikern, die in den Gedenkstätten sprachen, Versuche, die Arbeit der Gedenkstätte zu behindern und Misstrauen zu säen.
Wagner bleibt jedoch entschlossen, AfD-Vertreter von Gedenkveranstaltungen fernzuhalten, um die Würde der KZ-Überlebenden zu schützen und zu verhindern, dass geschichtsverfälschende Narrative legitimiert werden. Die AfD reagiert darauf mit weiteren Angriffen, wie der Forderung nach Wagners Entlassung. Wagner bleibt standhaft in seiner Überzeugung, dass die Erinnerung an den Holocaust zentral für die Demokratie in Deutschland ist.
Umfragen sehen die AfD vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen als stärkste Kraft. Eines der Themen, dass die in beiden Ländern als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei immer wieder politisch besetzt, ist der Umgang mit der deutschen Geschichte. Nationalsozialismus und Holocaust, DDR und friedliche Revolution – prägende Kapitel der deutschen Geschichte. Wie die AfD mit dieser Geschichte Politik macht, analysiert dieser Film.