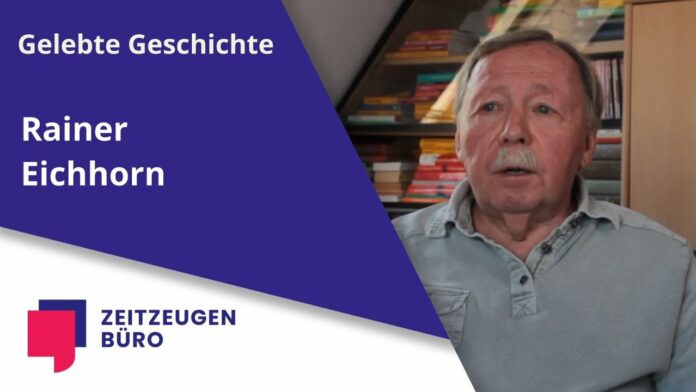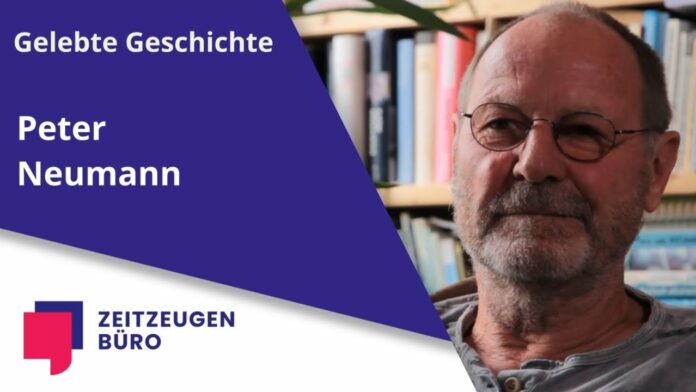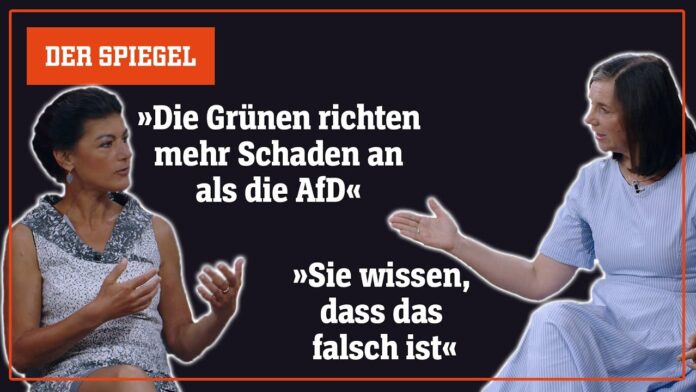Die Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe in Eisenhüttenstadt ist ein einzigartiges Beispiel für die Verbindung von historischem Erbe und moderner Bildung. Der 1957 errichtete Schulkomplex ist als Einzeldenkmal innerhalb des Flächendenkmals Eisenhüttenstadt anerkannt, was spezielle Anforderungen an seine Sanierung und Erweiterung stellt. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die Schule nicht nur ihre bauliche Substanz erhalten, sondern auch den wachsenden Anforderungen an den Bildungsbetrieb gerecht werden muss.
Im Jahr 2015 stellte die Schule fest, dass bestimmte räumliche und funktionale Vorgaben nicht mehr erfüllt werden konnten. Insbesondere fehlten geeignete Räume, die modernen pädagogischen Konzepten wie der Gruppenarbeit gerecht werden. Zudem zeigte sich, dass der Hausmeister unter verbesserten Bedingungen arbeiten sollte. Diese Erkenntnisse führten 2018 zur Antragstellung für eine Erweiterung des Schulgebäudes. Was zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht absehbar war, war das starke Wachstum der Schule. Mittlerweile lernen dort über 750 Schülerinnen und Schüler, unterstützt von einem engagierten Kollegium, das aus acht Lehrkräften besteht.
Die geplante Erweiterung stellt eine besondere Herausforderung dar. Einerseits soll ein moderner und nachhaltiger Bau entstehen, andererseits müssen die Planer die Denkmalschutzvorgaben berücksichtigen. Diese Balance zu finden, ist keine leichte Aufgabe, zumal die Erweiterung auch den Spagat zwischen Denkmalschutz und Kunst am Bau schaffen muss. Kunst am Bau ist ein wichtiger Bestandteil zeitgemäßer Schulneubauten, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend sein sollen. Ziel ist es, mindestens den Bronze-Status als zertifizierter nachhaltiger Bau zu erreichen.
Ein wesentliches Element des Erweiterungsprojekts ist die Einbindung der Schülerinnen und Schüler in die Gestaltung des neuen Gebäudes. In Zusammenarbeit mit dem Museum Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt entwickelten sie während einer Sommerkunstschule zahlreiche kreative Ideen für die künstlerische Gestaltung der Außenwand des zweiten Erweiterungsbaus. Diese bietet mit ihren 12 Quadratmetern Fläche ideale Voraussetzungen für die Umsetzung von Kunst am Bau. Bereits 1957, als die Schule von Otto Lopau entworfen wurde, spielten künstlerische Elemente wie Mosaiken, Wandbilder und Brunnen eine wichtige Rolle im Schulkomplex. Diese Tradition soll nun fortgeführt werden.
Unter dem Motto „Ein Wandbild macht Schule“ entwickelten die Schülerinnen und Schüler in drei Workshops verschiedene Ideen, die teilweise technisch anspruchsvoll sind. Eine Herausforderung bestand beispielsweise darin, den Tanz auf eine Wand zu bringen. Hierzu wurden interaktive Elemente diskutiert, wie die Integration von Monitoren, auf denen Aufnahmen abgespielt werden können, sowie die Möglichkeit, abstrakte Formen und Klanginstallationen zu kombinieren.
In einem anderen Workshop entstand die Idee, Keramikfliesen zu verwenden, die interaktive Klänge erzeugen können. Diese Fliesen sollen elektronisch verstärkt werden, sodass sie beim Anschlagen Töne erzeugen, die sich zu Rhythmen und Klangcollagen verbinden lassen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten auch daran, eine visuelle Sprache für diese Klänge zu entwickeln, sodass die entstandenen Melodien und Rhythmen reproduziert werden können. Neben der technischen Umsetzung lag der Fokus auch auf der künstlerischen Gestaltung der Wand. In einem weiteren Workshop unter der Leitung von Tim Köhler wurden verschiedene Kunstrichtungen erforscht, die als Inspiration für das Wandbild dienen sollen. Graffiti-Art, Mural-Art und Einflüsse aus der lateinamerikanischen Kunst sowie moderne Kunst und die Lebenswelt der Teenager wurden miteinander kombiniert, um ein einzigartiges Wandbild zu schaffen.
Die künstlerische Auseinandersetzung mit der Gestaltung der Schule ermöglichte den Schülerinnen und Schülern nicht nur einen kreativen Ausdruck, sondern auch eine tiefergehende Beschäftigung mit der Geschichte ihrer Schule. Sie lernten, die Vergangenheit zu schätzen und gleichzeitig ihre Visionen für die Zukunft einzubringen. Auch wenn nicht alle Ideen umgesetzt werden können, ist der Prozess selbst von unschätzbarem Wert. Er zeigt, dass die Gesamtschule 3 nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort der kreativen Entfaltung und der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist.
Wie die endgültige Gestaltung der Wand aussehen wird, bleibt spannend. Die Ergebnisse der Sommerkunstschule bieten jedoch einen faszinierenden Ausblick auf die zukünftige Verbindung von Kunst, Geschichte und Bildung an dieser besonderen Schule. Die kreativen Impulse der Schülerinnen und Schüler werden sicherlich dazu beitragen, das architektonische Erbe der Schule mit der modernen Schulkultur in Einklang zu bringen. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen die nächste Sommerkunstschule bereithalten wird und wie sich die Schule weiterentwickeln wird, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.