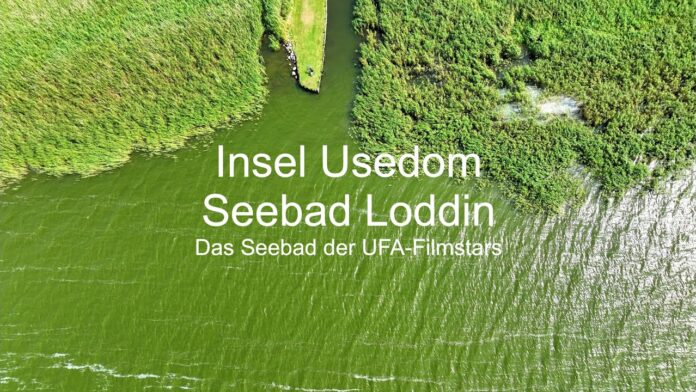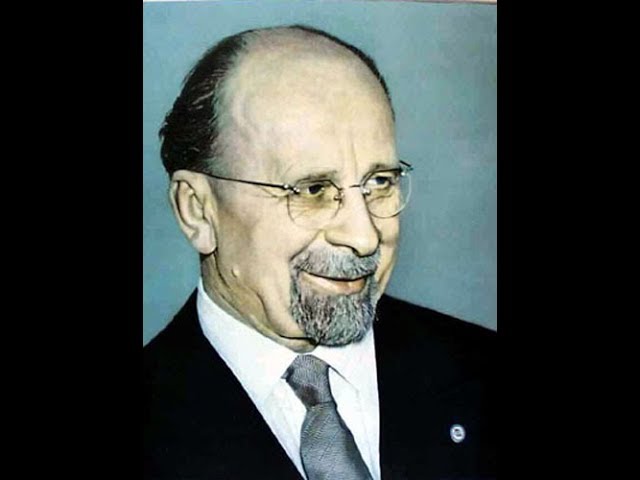Mit seiner 1,2 Kilometer langen Fassade und den monumentalen Hallen war der Flughafen Tempelhof einst das modernste Flughafengebäude der Welt. Heute steht es leer, bewacht und beheizt – und kostet Berlin jährlich über 20 Millionen Euro. Ein gigantisches Mahnmal: Einst Sinnbild von Macht und später Symbol der Freiheit, ist es mittlerweile ein Fass ohne Boden. Warum bezahlt die Stadt weiter Milliarden für ein Gebäude ohne Luftverkehr?
Vom Glanzbau zum „Rosinenbomber“-Tor
1936 eröffnete Tempelhof als Aushängeschild der nationalsozialistischen Hauptstadtplanungen: 300.000 m² Bruttogeschossfläche, sieben Etagen, 15.000 Räume, ein Dach, das mehr als 20 Flugzeuge gleichzeitig bergen konnte. Architekt Ernst Sagebiel entwarf damit nicht nur ein Flugtor, sondern eine „Kathedrale der Technik“. Doch schon ab Herbst 1939, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde der Flughafentraum zur Kriegsmaschine.
Erst 1948, mit Beginn der Berliner Luftbrücke, wandelte sich das Bild: Als die Sowjetunion alle Land- und Lieferwege abriegelte, wurde Tempelhof zum pulsierenden Herz West-Berlins. Alle drei Minuten setzte ein „Rosinenbomber“ auf, 270.000 Flüge und 2,3 Millionen Tonnen Hilfsgüter sorgten dafür, dass die eingeschlossene Stadt nicht unterging. Für viele Berlinerinnen und Berliner wurde der Flughafen zum Symbol des Überlebens und der Freiheit.
Stillstand und politisches Patt
Doch schon ab den 1970er-Jahren büßte Tempelhof an Bedeutung ein: Die Runways waren für moderne Jets zu kurz, effiziente Terminals fehlten, und Tegel rückte in den Fokus der Fluggesellschaften. 2008 hob zuletzt eine Maschine ab – tausende Schaulustige winkten der letzten Landung nach. Seitdem ist Tempelhof ein „schlafender Riese“.
Millionen Euro fließen jährlich in Heizung, Grundlast, Brandschutz, Schädlingsbekämpfung und Sicherheitsdienste. Allein die Lüftungsanlage verschlingt sechsstellige Summen. Ein Abriss gilt als unbezahlbar, denkmalrechtliche Auflagen und Schadstoffbelastungen erschweren Umbauten. Politik und Verwaltung hadern – risikoreiche Investoren und kompromissbereite Bürger fehlen.
Visionen versus Realität
Seit 2014 verhindern die Bürger per Volksentscheid jede Bebauung des Flugfelds. Das Areal vor den Hallen blieb frei – doch das Hauptgebäude selbst steht weiter leer. Ideen gibt es zuhauf: Stadtquartier, Kulturzentrum, Büroflächen, Start-up-Campus oder sogar Flüchtlingsunterkünfte. Genutzt wird daraus kaum mehr als 10 Prozent der Fläche.
Im Jahr 2023 begann das ambitionierte Dach-Sanierungsprojekt „Vision 2030 Plus“, geplant bis 2026. Die Zielvorstellungen klingen utopisch: Ein Ort für Kunst, Forschung, Bildung und Begegnung – ein „offenes Haus für alle Berlinerinnen und Berliner“. Doch bislang gibt es nur ein Konzeptpapier. Unklare Finanzierung, bürokratische Hürden und Denkmalschutz blockieren Fortschritte.
Wer trägt die Verantwortung?
Die politische Verantwortung liegt bei Senat und Bezirksamt: Sie müssten Struktur, Kosten und Zeithorizont transparent machen. Doch Investoren und Projektentwickler ziehen sich zurück, solange ungeklärt ist, wer Haftungsrisiken und Sanierungsmilliarden übernimmt. Im Endeffekt entscheidet die Koalition aus SPD, Grüne und Linke – und bislang läuft alles im Status quo-Modus weiter: reden statt handeln, bewachen statt beleben.
Ein Aufschub auf Kosten der Allgemeinheit
Während in Berliner Kitas händeringend Erzieher gesucht werden und in Krankenhäusern Personalmangel herrscht, zahlt jeder Haushalt für einen Flughafen ohne Flugzeuge. Rechnet man 20 Millionen Euro im Jahr über die nächsten zehn Jahre hoch, fließt eine halbe Milliarde Euro in leere Hangars und verfallende Bunkeranlagen.
Was wäre möglich? Neue Schulstandorte, zusätzliche Pflegekräfte, bessere Infrastruktur in Randbezirken – Projekte mit direktem Nutzen für alle Bürgerinnen und Bürger. Doch das Geld bleibt im Betonmonster stecken.
Wege aus dem Dilemma
Drei Szenarien bleiben:
- Investorensuche: Ein privater Partner mit Vision und Risikobereitschaft – sehr unwahrscheinlich, solange die Finanzierungslücke nicht geschlossen ist.
- Städtische Eigenverwaltung: Tempelhof als öffentliches Kultur- und Bildungszentrum, betrieben von GmbHs in öffentlicher Hand. Könnte Transparenz und Teilhabe steigern, erfordert aber enormes Management-Know-how.
- Status quo: Weiterzahlen, sanieren, hoffen – und beobachten, wie das Gebäude weiter verfällt.
Verpassen Berlin und seine Bürgerinnen und Bürger damit die Chance, einen historischen Ort sinnvoll weiterzuentwickeln? Oder ist der Erhalt eines solchen Monuments allein schon Grund genug, weiter in den Koloss zu investieren?
Tempelhof steht stellvertretend für Berlins ambivalenten Umgang mit Großprojekten: visionäre Ideen, langsame Umsetzung und massive Folgekosten. Ein Symbol für Freiheit und Macht, das heute Mahnmal verpasster Chancen ist. Bis zum Jahr 2030 wird weiter saniert – doch das wahre Projekt steht noch aus: die politische Entscheidung, Tempelhof wieder mit Leben zu füllen oder ihn endgültig als Denkmal zu begreifen, für das die Stadt weiterhin zahlt.