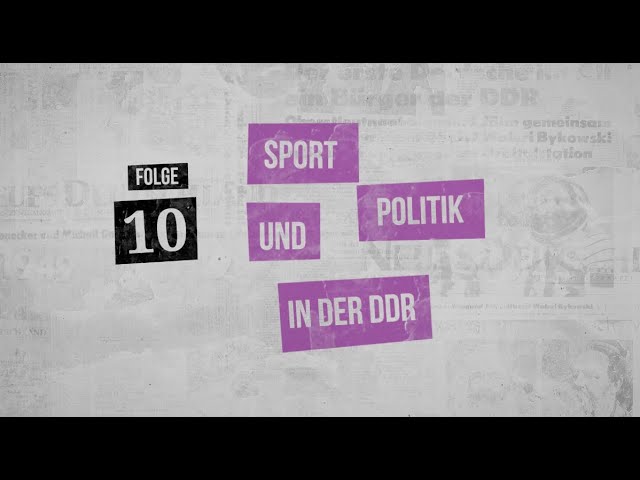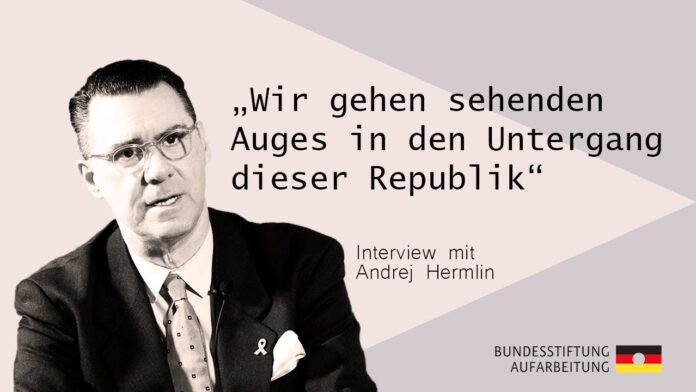Wie das Sinnbild sozialistischer Massenwohnungsbaugebäude zum gefragten Stadtquartier wird
Schmucklose Fassaden, endlose Reihen cast-grauer Betonplatten, einheitliche 1,20-Meter-Raster – noch vor wenigen Jahren galten die Plattenbauten der DDR als Inbegriff funktionaler Eintönigkeit und waren beliebtes Ziel westdeutscher Spottkampagnen. Heute jedoch erlebt der einst verpönte Wohntyp eine ungeahnte Wiederauferstehung: Von preiswerten Mietwohnungen bis zu aufwendig modernisierten „Edelplatten“ ist in ehemaligen Plattenbauvierteln die gesamte Bandbreite urbaner Lebensstile zu finden.
Die Anfänge: Effizienz und Ideologie
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Ostdeutschland akute Wohnungsnot. Am Anfang stand deshalb kein gestalterisches Konzept, sondern die drängende soziale Aufgabe, Menschen schnell und kostengünstig ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. In den 1960er Jahren entwickelte der VEB Industriebau das sogenannte WBS70-System: Vorgefertigte Betonfertigteile im 1,20-Meter-Modul konnten innerhalb von 18 Stunden zu einer kompletten Wohnung montiert werden. Die Plattenbauten boten erstmals Einbauküche, Zentralheizung, Duschen oder Badewanne – für viele Bewohner ein Quantensprung gegenüber Altbauwohnungen mit kalten Öfen und Gemeinschaftstoilette.
Doch der Baukastencharakter brachte eine Schattenseite mit sich. „Schnell gebaut, überall dasselbe“, fasste die DDR-Presse 1975 lakonisch zusammen. Die architektonische Monotonie stand auf den Titelseiten nahezu aller ostdeutschen Städte: Berlin, Leipzig oder Rostock – überall dieselben Hochhäuser.
Vom „Wohnparadies“ zum „Arbeiterschließfach“
Während in den Augen vieler DDR-Bürger der Plattenbau ein Fortschritt war – ein Stück moderner Sozialrepublik –, wandelte sich das Bild nach der Wende schlagartig. Westdeutsche Medien tauften das monotone Ensemble spöttisch „Arbeiterschließfach“ oder „Wohnklo mit Kochnische“. Die Architektur wurde zum Symbol der mangelnden Innovationskraft des SED-Regimes. Viele Alt-Bundesbürger sahen in den sterilen Hochhaussiedlungen nichts weiter als ein Mahnmal der Gleichschaltung.
Neubewertung und Sanierung: Wege aus dem Imagetief
In den 1990er und 2000er Jahren starteten Bund, Länder und Kommunen groß angelegte Sanierungsprogramme: Fassadendämmung, bunte Farbakzente, Balkone oder Loggien – wer heute durch die einst grauen Viertel streift, erlebt eine optische Verwandlung. „Die Sanierung hat nicht nur die Energiebilanz verbessert, sondern entscheidend zum Image-Wandel beigetragen“, erklärt Prof. Dr. Martina Klein, Stadtentwicklerin an der Technischen Universität Dresden.
Parallel dazu zog ein neuer Bewohnertipp: Junge Familien und Singles auf Wohnungssuche entdeckten die günstigen Mieten und die klassische Wohnviertel-Infrastruktur – Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten – für sich. Start-ups, Galerien und kleine Cafés mischten das ehemals homogene Bild auf.
Edelplatten und Hipster-Flair
An besonders attraktiven Lagen entstanden exklusiv modernisierte Plattenbauten – sogenannte „Edelplatten“ mit hochwertigen Materialien, Designküchen und Loft-Charakter. Im Berliner Friedrichshain oder Leipziger Plagwitz können solche Wohnungen inzwischen zu Preisen vermietet werden, die nahe am Stadtzentrum von München liegen. „Die ästhetische Reduktion der Plattenbauarchitektur hat eine eigene Ästhetik – minimalistisch, klar und funktional“, so Innenarchitektin Laura Meier, die mehrere Edelplatten-Projekte betreut hat.
Gleichzeitig etablierte sich in anderen Teilen der Stadt ein „Hipster-Plattenbau“: Graffiti, Street-Art und temporäre Kulturevents beleben Fassaden und Freiflächen. Plattenbau wird hier zum urbanen Experimentierfeld, dessen industrielle Anmutung bewusst zelebriert wird.
Serielle Bauweise im Wandel
Mit Blick auf die aktuelle Wohnungsnot in deutschen Großstädten gewinnt das Prinzip seriellen Bauens erneut an Bedeutung. Fertigteilbauweisen versprechen günstige Preise und kurze Bauzeiten – Lektionen, die Politik und Bauwirtschaft aus den DDR-Erfahrungen ziehen. Energieeffizienz und gestalterische Vielfalt müssen künftig besser verknüpft werden, wenn der Plattenbau als Vorbild einer modernen, nachhaltigen Wohnungspolitik dienen soll.
Der Plattenbau hat den weiten Weg vom sozialistischen Musterquartier über das Ziel westlichen Spottes bis hin zur facettenreichen Wohnidee hinter sich. Er bleibt ein Spiegel gesellschaftlicher Debatten – und lehrt zugleich, wie Architektur neu bewertet, umgedeutet und wiederbelebt werden kann.